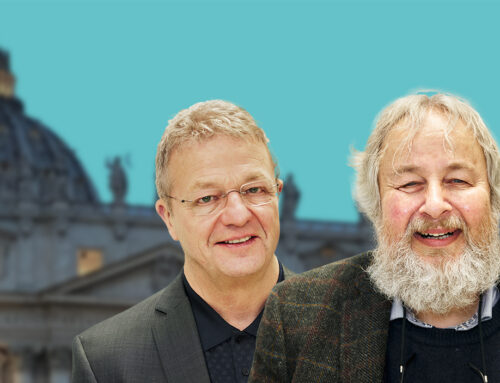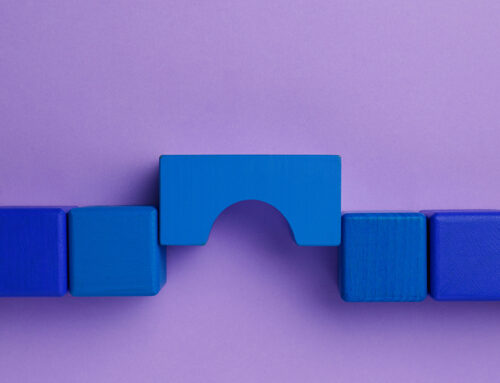Das römische Dokument „Dignitas infinita“ lädt ein, aus der Fülle der Identität als Erben Christi zu leben, statt eigene Identitäten zu konstruieren. So sieht das jedenfalls unsere Autorin, Dorothea Schmidt und leistet damit einen bedenkenswerten Diskussionsbeitrag.
Nach Erscheinen der römischen Erklärung „Dignitas infinita“ ist eine Fülle an kritischen Kommentaren unter Bezugnahme auf die Transgender-Anthropologie erschienen. Sie machen auf einen weiteren, mit der Würde des Menschen unmittelbar zusammenhängenden Aspekt aufmerksam, der jeden betrifft: die Suche nach der Identität.
Christen wissen — und das sagt auch „Dignitas infinita“ —, dass jeder Mensch eine unendliche, in sein Sein eingeschriebene, Würde besitzt, weil er von Gott gewollt, geschaffen und geliebt ist. Diese Würde gilt in alle Ewigkeit, „unabhängig von körperlichen, psychologischen, sozialen oder sogar moralischen Mängeln“ und unabhängig von jeder glanzvollen oder nur mehr oder weniger guten Leistung, die ein Mensch erbringt. Soweit die Theorie.
Leben mit angezogener Handbremse . . .
Die Praxis zeigt, dass sich die von der Gesellschaft propagierte und auf Leistung basierende Mentalität tief im Menschen verankert hat — Christen sind davon nicht ausgenommen: Bewähre dich, leiste was, dann bist du wer (Identität), wirst anerkannt und fühlst dich wertvoll (Würde). Die amerikanische, katholische Initiative „Encounter ministries“ nennt dies eine Waisenkind-Mentalität; der Mensch geht mit angezogener Handbremse durchs Leben und tut alles, um jemand zu sein — wobei er seine Identität von Leistung und Erfolg abhängig macht. Jesus predigte aber nicht, möglichst effizient zu sein, sondern treu.
„Dignitas infinita“ erklärt, dass die Würde der Person „eben nicht erst im Nachhinein verliehen“ wird; sondern „sie geht jeder Anerkennung voraus und kann nicht verloren werden.“ Die wichtigste Sinngebung sei „an die ontologische Würde gebunden, die der Person als solcher allein durch die Tatsache zukommt, dass sie existiert und von Gott gewollt, geschaffen und geliebt ist“. Sie entspringe „der Liebe seines Schöpfers, der ihm die unauslöschlichen Züge seines Ebenbildes eingeprägt hat“ — zu dem auch der Körper gehört. Kurz: Wir sind (jemand), und aus diesem Wissen handeln wir. Das ist auch die Voraussetzung für die Nachfolge Jesu, die Jüngerschaft.
. . . versus Leben in der Fülle Gottes
Ebenbild Gottes und Gottes Kind zu sein, ist die tiefste Identität des Menschen. In Jesaja spricht Gott jedem Menschen zu:
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir.“
Gott selbst spricht jedem Menschen seine Identität zu. Das macht Selbstzweifel völlig überflüssig. Benedikt XVI. sagte: Die Erinnerung an Gott Vater „erhellt die tiefere Identität der Menschen: woher wir kommen, wer wir sind und wie groß unsere Würde ist. … Daher steht am Anfang jedes Menschen nicht der Zufall oder eine Fügung des Schicksals, sondern ein Plan der göttlichen Liebe.“
Vom Waisenkind zum Gotteskind
Hier setzt auch „Encounter ministries“ an: Wenn der Christ um seine Identität, die in der Gotteskindschaft liegt, weiß und aus ihr heraus handelt, ist er auch fähig, das Erbe Christi als Getaufter in Empfang zu nehmen (Die Gläubigen sind dann durch die Gnade Christi Kinder Gottes und somit auch „Erben Gottes und Miterben Christi“ (vgl. Röm 8,17). Darum lädt die Initiative ein, sich auf eine Schule des Glaubens und Betens einzulassen, in der man befähigt wird, diese Identität in der Begegnung mit Christus zu erfahren und aus ihr heraus zu leben — nicht mehr als Waisenkinder, sondern als Gotteskinder, die um das Erbe wissen, das ihnen anvertraut wurde und um die Werke, die Jesus vollbracht, auch zu vollbringen — sogar noch größere (vgl. Joh 14,12). Die dem Menschen von Ewigkeit her zugesprochene und innewohnende Identität und Würde werden hier in der Begegnung mit dem Auferstandenen buchstäblich er-lebt. Wie Robert Spaemann einmal formulierte, ist Würde eine bestimmte Art ein Selbst zu sein, das Anerkennung verlangt, weil es auf ein Unbedingtes bezogen ist. Anders formuliert: Identität speist sich aus der Gottesbeziehung.
Dagegen: Wenn der Mensch das Unbedingte, also Gott, negiert, erklärte Benedikt XVI., dann „verliert er den göttlichen Glanz auf seinem Angesicht. Schließlich erweist er sich nur als Produkt einer blinden Evolution und als solches kann er gebraucht und missbraucht werden“.
Sexualität als Maßstab für die Identität?
Nach der Transgender-Ideologie heißt das: Passt die Biologie nicht zum Gefühl, kann man das Geschlecht ändern — ein Denken, das seit dem 12. April 2024 im Selbstbestimmungsgesetz gesetzlich offiziell bestätigt und festgeschrieben ist. Wird die sexuelle Orientierung zum Maßstab erhoben, der zwingend anzuerkennen sei, dann wird damit auch verlangt, die Lebensform, die aus dieser Form des Begehrens resultiert, als Maßstab für die Identität anzuerkennen. Aus der versucht der Mensch dann, seine Würde abzuleiten. Oft wird Identität dabei allein von der sexuellen Orientierung hergedacht, sie ist jedoch nur ein Aspekt der Identität eines Menschen, wie auch „Dignitas infinita“ ausführt.
Der Mensch als Selbstentwurf
Leitgedanke der Transgender-Ideologie ist, dass der Mensch die Wirklichkeit produzieren und sich seine geschlechtliche Identität selbst konstruieren kann. Dies impliziert aber, den Menschen nicht mehr als Geschöpf Gottes zu betrachten, sondern, wie Benedikt XVI. es formulierte, als Produkt und Konstrukt des Menschen, bei dem die Autonomie im Vordergrund steht. Oder um es mit der Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz zu sagen: „Die leidenschaftlich geführte Auseinandersetzung über die Geschlechterfrage beruft sich auf Autonomie – gegen die Natur.“ Der Mensch werde zum Selbstentwurf.
Dieses Denken basiert auf einer konstruktivistischen Metaphysik, die die letzten Strukturen der Wirklichkeit und die Anthropologie, wie sie die Kirche seit je her lehrt, verdreht. Darum muss die jetzt noch hitzige, durch „Diginta infinita“ ausgelöste Debatte geführt werden, denn betroffen ist der Mensch selbst, in seinem tiefsten Sein — mit oft fatalen Folgen, wie Skandinavien, Großbritannien und die Niederlande spiegeln, die mit ähnlichen Gesetzen zur „Geschlechter-Selbstbestimmung“ bereits derart schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie nun zurückrudern.
In Großbritannien zum Beispiel wurden in den vergangenen 15 Jahren Jugendliche mit Pubertätsblockern und Hormonen behandelt. Wie die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) vor zwei Wochen berichtete, liegt dort ein Untersuchungsbericht vor, der geradezu nach einer Trendwende schreit. Darin erklärt die Kinderärztin Hilary Cass, „dass den meisten Betroffenen mit einer breiteren Behandlung ihrer psychischen Probleme besser gedient sei als mit medikamentösen und hormonellen Eingriffen“. Kinder müssten als ganze Personen betrachtet werden „und nicht nur durch die Linse ihrer Gender-Identität“, schreibt sie. Zuvor war einer Klinik vorgeworfen worden, Minderjährige zu einer Behandlung mit Pubertätsblockern und Hormonen gedrängt zu haben. Die Klinik musste schließen.
Negative Erfahrungen mit Transgender reichlich vorhanden
Auf solche „besorgniserregenden Erfahrungen in anderen Ländern“ hat jüngst auch die Frauen-Union Euskirchen in Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsgesetz hingewiesen. Die Frauen wiesen auch auf zu erwartende Ungerechtigkeiten beim Sport hin, wenn muskelbepackte Transfrauen gegen Frauen antreten würden, und schreiben, die Meinungsfreiheit sei in Gefahr. Dass dies nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt folgendes Szenario, das sich vergangenes Jahr in England zugetragen hat: Das ganze Land diskutierte bis in Regierungskreise hinein, ob es in Ordnung sei, Mädchen zu schelten, die es als „spinnert“ bezeichneten, wenn eine Klassenkameradin sich als Katze identifiziere. Eine Lehrerin wollte diese Mädchen, die das biblische Menschenbild vertraten, von der Schule verwiesen sehen.
Zurück zur Frauen-Union. Die Frauen geben auch zu bedenken, dass Schutzräume für Frauen faktisch abgeschafft und Tür und Tor „für bewusste Provokation und Missbrauch“ geöffnet würden, wenn biologische Männer als Frau Zugang zu Schutzräumen bekämen. Und schließlich warnen sie vor den Nebenwirkungen von Pubertätsblockern (wie Krebs, Schlaganfall, Blutgerinsel).
Internationale aussagekräftige Studien, die es zum Thema gibt, zeigen außerdem, dass Selbstmordarten bei Menschen steigen, psychische Erkrankungen nicht zwingend verschwinden und Betroffene nach der Geschlechtsumwandlung feststellen müssen, dass dies gar nicht die Lösung ihrer wahren Probleme war; es aber kein Zurück gibt — außer nach dem Tod, wenn der Mensch aller Wahrscheinlichkeit nach als der von Gott geschaffene (und nicht veränderte) Mensch auferstehen wird.
Die Identitätsfrage bleibt und verlangt nach Antwort
Hinter der Transgender-Problematik wie hinter der Waisenkind-Mentalität steht die offene Frage nach der eigenen Identität. Immer wieder kommt „Dignitas infinita“ auf die Essenz zurück, die den herumirrenden Menschen letztlich zurückführen möchte ins eigene Sein, in sein inneres Zuhause: Der Mensch hat bereits eine Identität inklusive unendlicher Würde erhalten. Aber Menschen dürfen das nicht nur immer wieder hören, sondern müssen es auch erfahren. Aus der Dogmatik des geglaubten Geliebtseins muss die psychologische Erfahrung des tatsächlichen Geliebtseins hervorströmen. Hier sind die christlichen Kirchen besonders gefragt.
Benedikt XVI. brachte es in einem seiner Werke auf den Punkt:
„Wir müssen Gemeinden aufbauen und zugänglicher machen, die die große Gemeinde der lebendigen Kirche widerspiegeln. Es gehört alles zusammen: die lebendige Erfahrung der Gemeinde, mit all ihren menschlichen Schwächen, die aber dennoch real ist, mit einem klaren Weg und einem festen sakramentalen Leben, in dem wir auch das berühren können, was uns so weit entfernt erscheinen mag, die Gegenwart des Herrn.“
In Seiner Gegenwart darf der Mensch trotz aller Schwäche einfach sein — ein unendlich wertvolles und geliebtes Kind Gottes.
Dorothea Schmidt
arbeitet als Journalistin und regelmäßige Kolumnistin für diverse katholische Medien (Tagespost, kath.net, u.a.). Sie ist Autorin des Buches „Pippi-Langstrumpf-Kirche“ (2021). Sie war Mitglied der Synodalversammlung des Synodalen Weges und verließ gemeinsam mit weiteren Frauen Anfang 2023 das Gremium als Protest gegen die Beschlüsse des Synodalen Weges, die sich immer weiter von der Weltkirche entfernen. Schmidt ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Süddeutschland.
Der Artikel erschien am 26. April in der tagespost.
Bild: Adobe Stock