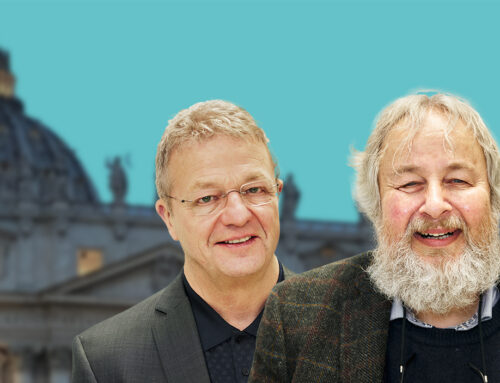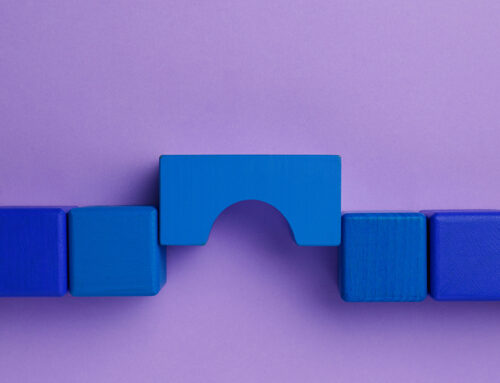Wir sollten nicht mit billiger Gnade trösten, da wir mit teurer Gnade erkauft worden sind. Zu diesem Schluss kommt Helmut Müller bei seiner kritischen Betrachtung eines Aufsatzes zu Martin M. Lintner, den er wissenschaftlich unter verschiedenen Aspekten durchleuchtet.
Seelsorge zwischen Verständnis, Annahme und billiger Gnade
Martin M. Lintners Aufsatz Gottgewollte Wirklichkeit. Sexuelle Diversität als theologische, ethische und praktische Herausforderung verdient eine kritische Auseinandersetzung. „Irgendwo blutet jeder Mensch“ hatte Hans Urs von Balthasar einmal vor einer Versammlung von Menschen aus geistlichen Gemeinschaften in München hingewiesen. Jeder einzelne Mensch, über die von Martin M. Lintner genannte Gruppe hinaus, bedarf also einer pastoralen, besser noch spirituellen Begleitung, die das Geliebtsein von Gott verstärkt und bestätigt. Das ist das Ziel von Lintners Denkansatz. Warum also im Folgenden eine kritische Stellungnahme? Auf drei Dinge möchte ich dabei hinweisen:
1. Humanwissenschaftlicher Einwand:
Humanwissenschaftliche Fakten werden häufig aktualistisch, nur wirkursächlich, um nicht zu sagen kausalmechanisch und daher nicht in finale Prozesse eingebunden, beurteilt. Es wird versäumt Lebenswirklichkeiten in der Spannung zwischen Natalität und Mortalität (Hannah Arendt) zu verstehen.
Martin Lintner wirft kirchlichen Instanzen vor, humanwissenschaftliche Einsichten zu wenig zu berücksichtigen: „Auch die human- und sexualwissenschaftlichen Einsichten, dass die geschlechtliche Identität eines Menschen eine komplexe Kombination von mehreren, ganz unterschiedlichen Aspekten und Eigenschaften ist, wird noch kaum berücksichtigt.“ Dazu ist folgendes zu sagen: Natürlich wird das berücksichtigt, z. B. von der australischen Bischofskonferenz. Lintner folgt einer Tendenz, humanwissenschaftliche Erkenntnisse nur kausalursächlich nicht auch finalursächlich zu reflektieren. Letzteres ist für das Begreifen von Lebendigem unverzichtbar. So verbleiben Fakten oft nur in einem aktualistischen Blickfeld der konkreten Lebenswirklichkeit haften und werden nicht oder nur ungenügend in ihrem finalen Gesichtsfeld beurteilt. In Bezug auf Farbenblindheit beim Menschen würde das bedeuten, das aktuelle Faktum – Schwarzweißsehen – wäre alternatives Sehen ohne Bezug auf das Verfehlen des gesamten Spektrums menschlichen Sehens. Auf die Ausprägung menschlicher Sexualität bezogen wird offensichtlich davon abgesehen, dass dieselbe von ihrer ersten aktuellen Präsenz im Genom als XX bzw. XY schon final auf Generativität ausgerichtet ist. Schon in der gesamten vorausgehenden Stammesgeschichte war dies der Fall und in der ontogenetischen Entwicklung ebenfalls. Auf den Menschen bezogen drängt sich bei Lintner und anderen Moraltheologen der Eindruck auf, dass Generativität nur beiläufig, als eines von vielen Segmenten unter anderen Alternativen aktualisiert werden kann.
Begehren, lebenslange Treue, Fruchtbarkeit – nur Segmente des Liebens?
Bei dem Mainzer Moraltheologen Stefan Goertz wird dies überaus deutlich. Die Kirche habe sich „von den Humanwissenschaften aufklären zu lassen“, fordert er. Das ist zunächst nicht verkehrt, aber Goertz meint damit, die alte Fixierung auf Sexualität in der Ehe und auf die Fortpflanzung sei aufzugeben. Er meint weiter, dass „die Zeit der kirchlichen, moralischen Bevormundung der menschlichen Sexualität wohl tatsächlich unwiderruflich vorbei ist“. Finale Prozesse in der Natur gibt es nach Goertz in solchen Perspektiven offensichtlich nicht. Es sieht so aus als ob Prozesse allein vom Menschen autonom und final zu von ihm bestimmten Zielen geführt werden. Das liest sich dann so: „Menschen wissen auch ohne Katechismus zum einen, was es mit der menschlichen Sexualität auf sich hat und zum anderen, wie man diese auch moralisch verantwortet leben kann“. Wir würden zudem in einer Zeit leben, in der Sexualität ihre Ausrichtung auf Nachkommenschaft und ihre soziale Funktion eingebüßt hat. Kausalursächliche Anfänge werden offensichtlich durch eine autonom begriffene Vernunft final bestimmt. Möglicherweise ist Lintner und Goertz die finale Verfasstheit alles Lebendigen in ökologischer Hermeneutik vom Pantoffeltierchen im Wassertropfen bis zu den Wanderbewegungen der arktischen Eisbären bekannt. Aber die eigene finale Verfasstheit ist ihnen anscheinend unbekannt. Sie steht wohl der Selbstbestimmung im Wege.
Die Übergriffigkeit der physikalisch-chemischen Betriebsstruktur
Dazu ist Grundsätzliches zu sagen: Die quantitative und materialistische Verfasstheit der Naturwissenschaft greift immer wieder vom bloß physikalisch-chemischen in die Wissenschaften des Lebendigen über. Hans Jonas mit seinem Buch „Organismus und Freiheit“ (1973) und Adolf Portmann mit seinem ganzen Lebenswerk, etwa in „Biologie und Geist“ (1. Auflage 1956) haben auf diese Übergriffigkeit der quantitativen Methode in die Lebens- und auch in die Humanwissenschaften hinein hingewiesen. Neuerdings sind das sehr leserfreundliche Werk von Andreas Weber „Alles fühlt“ (2008) und Spyridon Koutroufinis, Organismus als Prozess. Begründung einer neuen Biophilosophie 2019 zu nennen. In der Theologie gehört es mittlerweile regelrecht zum guten Ton auf den Humanwissenschaften zwar zu reiten, um so Sattelfestigkeit in einer fremden Disziplin und damit Wissenschaftlichkeit vorzutäuschen, aber die Reitkünste sind mehr als bescheiden, wenn man sie mit oben genannten Veröffentlichungen konfrontiert.
Hans Jonas und die anderen Kritiker der Übergriffigkeit quantitativer Methoden in die qualitative spezifische Verfasstheit der Wissenschaften des Lebendigen, kritisieren an diesen Methoden, dass sie sich nur – wie die Naturwissenschaften – mit Wirkursachen abgeben. An dieser Stelle muss auch auf Robert Spaemann und Reinhard Löw verwiesen werden mit ihrem Buch Natürliche Ziele. Alle Prozesse des Lebendigen werden mit dieser reduktiven Berufung auf Ergebnisse der Humanwissenschaften wie Lintner und Goertz es tun, reduktiv aktualistisch beurteilt.
In Kunstharz gegossene Lebenswirklichkeiten und ihre verfehlten Ziele
Die angezielte Lebensordnung, etwa die Generativität des Individuums, und seine Einbettung in die soziale Eingliederung humanen Lebens und seiner Institutionen, kommt gar nicht in den Blick. Sexuelle Diversität wird nur in der individuellen Lebenswirklichkeit aktualistisch reflektiert, etwa dass man sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt. Das Ziel gegengeschlechtlicher Anziehung als Voraussetzung individueller, partnerschaftlicher Generativität oder dergleichen in einem Sozialgebilde, wird als natürliches Ziel abgelehnt. Dass ein solches Ziel kurz- oder langfristig und überhaupt verfehlt wurde, wird in der Regel gar nicht thematisiert. Die gerade vorliegende Lebenswirklichkeit wird wie in Kunstharz eingegossen, behandelt. Weh dem, der versucht diese eingegossene Lebenswirklichkeit jenseits von autonomer Selbstbestimmung zu reflektieren! Dabei ist es wichtig, an neuralgischen Punkten besonders aufmerksam zu sein. Offene Zeitfenster in der Kleinkindphase oder der Pubertät in der Perspektive der Sexualpädagogik, dürfen nicht durch dirigistische Interventionen oder manipulative Impulse gestört werden. Die Pubertät ist ein regelrechter Kipppunkt im natürlichen Umbau des Kindes zum Mann oder zur Frau und zu nichts anderem! Wenn es da Identitätsprobleme gibt, können und sollten sie nur individuell reflektiert werden. Das ist dann der Ort pastoraler und spiritueller Sorge.
Vorschnelle Fixierungen an Kipppunkten
In einem noch fluiden Feld zwischen männlich und weiblich, etwa in der Pubertät, muss vor schneller Fixierung auf eine gefühlte Identität und der Zuschreibung zu anderen Geschlechtern gewarnt werden. Da ist dann das ganze Spektrum von Humanmedizin bis Spiritualität gefragt, und es steht eine individuelle, personale Wirklichkeit zur Debatte, die sich vielfach als widerspenstig erweist, in eine finale Zielgestalt zu münden. Wenn Diversität im Raum steht, darf ihre gerade aktuale Verfasstheit nicht vorschnell fixiert werden, sondern bedarf einer Beurteilung in komplexer Prozesshaftigkeit und es darf nicht davor zurückgescheut werden, eines der natürlichen Ziele, die Spaemann/Löw ausführlich beschreiben, als verfehlt zu erkennen.
Alles Lebendige ist von einer komplexen stammesgeschichtlich-ontogenetischen Herkünftigkeit, im Fall des Menschen – schon als vorgegebene, aber auch als aufgegebene Natalität, zu begreifen (H. Arendt). Diese Herkünftigkeit ist auf eine sich individuell und personal auszeitigende originelle Zukunft gerichtet. Wir sind dabei nicht in die Lust des Augenblicks oder die Phantasmagorien einer Entwicklungsstufe eingeschweißt – eine Lust, die (nach Nietzsche Mortalität negierend) allerdings Ewigkeit will. Alles Lebendige will einmal die eigene Zukunft und zum anderen die der Art.
Identität in ihren Spannungsfeldern
Identität ist nicht als etwas rein Individuelles zu verstehen. Nicht einmal der männliche arktische Eisbär, der – wie es seine Art fordert – einsam jenseits des Polarkreises seine Kreise zieht, ist ein solcher Erz-Individualist – gar nicht zu reden von homo sapiens, dessen Identität in ein komplexes Setting von Sozialität eingebettet ist. Fehlt diese Ausrichtung, etwa im Falle der Generativität in Bezug auf die Art, ist das nach Lintner und Konsorten offenbar dennoch gottgewollt „gut“ im Sinne von Genesis 1 und siehe es war gut. Genesis 3 wird theologisch genauso wenig bedacht, wie die spezielle Verfasstheit des Lebendigen bei manchen Bezügen auf die Humanwissenschaften nicht beachtet wird. Die Sozialsysteme werden in ihrer auf Generativität gründenden Genesis nicht begriffen, insbesondere Stefan Goertz scheint das wie oben ausgeführt, zu ignorieren.
2. Theologischer Einwand
Martin M. Lintner differenziert nicht zwischen von Gott gewollt und von Gott geliebt. Er schreibt: „Sie fühlen sich nicht trotz, sondern mit ihrer geschlechtlichen Identität von Gott gewollt und geliebt, sodass sie auch an ihr kirchliches soziales Umfeld – sei es eine Pfarre, sei es eine Ordensgemeinschaft – die Erwartung stellen, als die Menschen, die sie sind, angenommen, wertgeschätzt und bejaht zu werden.“
Von Gott gewollt wird äquivok gesetzt mit von Gott geliebt. Warum? Das Dogma von der Erbsünde, das auf der Sündenfall-Erzählung in Gen 3 beruht, erklärt die Differenz zwischen Gottes gutem Schöpfungsplan, wie er in Gen 1 + 2 in das zufriedene Zurücklehnen des Schöpfers mündet („… und siehe, es war sehr gut!“) und der faktischen Gebrochenheit, die jeder Mensch an sich erfährt. Lintner und Goertz versuchen nun, queere Vorfindlichkeiten vor dem Sündenfall zu etablieren, sozusagen als weitere kreative Erfindungen Gottes neben der „Heteronormativität“, – als könnten diese Personen nur so von Gott geliebt sein.
Der Verfasser der Erzählung vom Sündenfall konfrontiert den Leser gleich mit einem fünffachen Bruch in der Lebenswirklichkeit des Menschen, die offenbar nicht mehr so anzutreffen ist wie in Gen 1 konzipiert. Es sind die Brüche
- mit Gott,
- mit der Welt,
- mit sich selbst,
- mit dem Lebenspartner und
- dem Leben selbst.
Eine Pastoral, die diese Brüche weitgehend ausgrenzt – im Hinblick auf unsere Sexualität hat man manchmal den Eindruck, als sei sie das einzig heil gebliebene Stück aus Gottes ursprünglicher Schöpfung – macht es sich zu leicht. Lintner geht in seinem Beitrag – den er auch noch Gott gewollte Wirklichkeit nennt – mit keinem Wort auf diese Brüche ein. Hier wird plötzlich die in den Text implantierte Empathie zur vergifteten „billigen Gnade“. Das Leiden der Betroffenen wird ursächlich komplett als Empathielosigkeit dem sozialen Umfeld angelastet bis zu systemischen Verfestigungen in Staat, Gesellschaft und Kirche, insbesondere deren rückständigem Lehramt. Auf dieser dunklen Folie kann dann ein pastoral Sorgender als Erleuchteter, quasi sogar Heiland der Welt, in entsprechendem Kleinformat auftreten. Man erspart sich die Auseinandersetzung mit einem – scheinbar aus der Zeit gefallenen – widerborstigen Text, wie ihn Genesis 3 offeriert.
Billige Gnade und gratismutige Empathie
Klar, das Festhalten an einer ursprünglichen Tat, die den gnadenhaften Urstand von Gen 1 zunichte macht und nicht nur die ersten Menschen aus der paradiesischen Nachbarschaft Gottes heraus bricht, ist nach Rousseau kaum zu vermitteln. Wir werden sozusagen als Spätgeborene in eine Schuldknechtschaft geradezu hineinverfügt. Aber schon im Katechismus wird unterschieden zwischen einer ursprünglichen Tat und einem Zustand, in dem sich jeder von uns schon vorfindet, mit all den genannten Brüchen, die so oder so in unserem Leben sogar unverschuldet aufbrechen können. Wir können zu Opfern werden, bevor wir in die Täterfalle tappen, aber auch bewusst Täter werden. All diese Überlegungen, erspart sich nicht nur Martin Lintner, sondern das Gros, der momentan an deutschsprachigen theologischen Fakultäten lehrenden Personen und auch nicht wenige Bischöfe. Zugegeben Erbsünde-Dogma ist ein harter Brocken. Zwei Dinge sind festzuhalten:
- Es steht eine Tat am Anfang: Ist sie als historisches Datum zu verorten oder schwer erkennbar im blanc de l’origine (im weißen Punkt des Anfangs) Teilhard de Chardins, dem paläontologischen Dunkel des Tier-Mensch-Übergangsfeldes zu suchen, vom Pongiden zum Anthropoiden oder erst Hominiden oder gibt es ein solches Übergangsfeld gar nicht? Die Tat, die den Menschen aus dem ursprünglichen gnadenhaften Urstand in die Zeitachse kosmischer Wirklichkeit stürzt, bleibt rätselhaft.
- Der Zustand von uns selbst mit seinen Brüchen und auch solchen schon in der Welt zeigt, dass metaphysische und theologische Überlegungen nicht übergangen werden können, da Brüche zwar kosmisch wirksam werden, aber präkosmische Dimensionen geradezu als Denkhorizont herausfordern. C. S. Lewis in seinen Narnia-Chroniken, seiner Perelandra-Trilogieund J. R. R. Tolkien im Herrn der Ringe haben in ihrem Lebenswerk das christliche Dogma literarisch zu fassen versucht, da es rein rationalen Überlegungen rätselhaft bleibt.
Kein Wunder – ich will in der Metaphorik der beiden Angelsachsen bleiben – vor diesen Hürden scheuen immer mehr Theologen, wenn sie ein Pferd – das, wie sie meinen mit diesem historischen Dogmen-Ballast von Augustinus gesattelt wurde, reiten müssen. Aber es ist keine Lösung, wenn Leute wie Lintner dieses Pferd erst gar nicht besteigen und dann auch nicht darauf reiten. Diese Scheu greift immer mehr um sich und ermöglicht eine scheinbar empathische Beurteilung der Brüche in unserer Sexualität, in dem nur die anderen die Schuldigen sind und Brüche im eigenen Leben, verschuldet oder unverschuldet, tabu bleiben.
3. Pastoraler Einwand:
Ein vielfältiges Minderheitenschicksal von einzelnen wird an neuralgischen Kipppunkten schon als fixiert verstanden, während es an eben diesen Punkten vielfach noch fluide ist. „Das Lehramt und die Theologie stehen hier vor der Aufgabe, die Zweigleisigkeit zwischen pastoralem Verständnis für Menschen in bestimmten Lebenssituationen und der moralischen Verurteilung von Beziehungsformen, die nicht der kirchlichen Lehre entsprechen, zu überwinden.“
Der Artikel hat bei mir folgenden Eindruck hinterlassen: Da geht jemand mit großer Empathie auf Menschen zu, die sich in der Vergangenheit und auch der Gegenwart in vielfältiger Weise sozial isoliert und diskriminiert gefühlt haben und fühlen. Isoliert, diskriminiert wird aber immer mehr zum wohlfeilen Opferstatus – der stärksten Bastion – von der sich argumentieren lässt. Bei einer Million Besuchern des CSD-Tages in Köln, Hunderttausenden in Berlin und in Stuttgart am darauf folgenden Wochenende, mit durchaus freundlicher Berichterstattung – ist der Vorwurf der Isolation und Diskriminierung schwer nachzuvollziehen. Nicht anders in Frankreich, wenn Queerness als dominante, durchgehende Inszenierung der olympischen Spiele erkennbar wird und Emmanuel Macron dann sagt: „Das ist Frankreich“. Das soll nicht heißen, dass das Beklagte nicht weiter vorkäme. Klagen sollten also weiter ernst genommen werden, wenn sie konkrete Personen betreffen. Pressure groups dagegen sind keine Objekte pastoraler Seelsorge. Lintners Beitrag ist tatsächlich mit großer Empathie geschrieben worden, allerdings einer Empathie, die auf Kosten lehramtlicher Aussagen erkauft worden ist.
Empathie auf Kosten lehramtlicher Klarheit
Daran ist Lintner offensichtlich nicht alleine schuld; auch andere wagen es nicht, den Mainstream „billiger Gnade“ zu durchbrechen. Es hat sich nämlich eingebürgert, dass man sich zwar auf eine verständliche Opferperspektive eingelassen hat, aber auf Kosten nicht nur lehramtlicher Verlautbarungen, sondern auch auf Kosten gründlicher humanwissenschaftlicher Analysen des Sachverhalts. Wie das? Aufgrund von tatsächlichen Diskriminierungen, Ausgrenzungen, Isolation, Stigmatisierungen ist man auf Forderungen der Opferseite bedenkenlos eingegangen, wenn gefordert wird, dass ihre Befindlichkeit als gottgewollt zu betrachten ist. Eine ganze Reihe von Bischöfen und Weihbischöfen, gar nicht zu reden von Theologen, haben sich mit diesem Wording vorbehaltlos auf die Sicht der Opferseite begeben. Sie haben Barmherzigkeit mit den Betroffenen walten lassen – das ist richtig – aber daraus ist vielfach „billige Gnade“ geworden, weil man sich die Sachverhalte nur einseitig ansieht und Barmherzigkeit walten lässt, ohne sie mit der Tugend der (Sach-)Gerechtigkeit lehramtlicher Aussagen zu konfrontieren. Der Essener Weihbischof Ludger Schepers fordert auf, keine Mauern, sondern Brücken zu bauen. Die sollten dann aber solide sein und keine Knüppeldämme, die wieder überflutet werden können. Denn Brücken bauen ohne Brüche zu thematisieren und ohne in Abgründe zu schauen, über die diese Brücken führen sollen, ist mit Bonhoeffer gesprochen „billige Gnade“ oder anders gewendet: Barmherzigkeit walten lassen, ohne über (Sach)-Gerechtigkeit zu reflektieren. Mir ist bewusst, dass es sich um eine pastorale Herausforderung handelt, wenn man schon einmal queeres Lieben als Gott gewollt oder so wie Gott mich schuf abgesegnet hat. Selbstverständlich liebt Gott jeden wie er ist, aber er hat uns nicht so gewollt wie wir uns vorfinden.
Wer baut schon Häuser im Wattenmeer und lebt lebenslang im Zwielicht?
Es ist wenig hilfreich wenn mit Wattenmeer oder Dämmerungsmetaphern versucht wird, die Brüche als Schöpfungstaten Gottes schön zu reden und ihnen sogar Schöpfungsqualitäten zuzuschreiben: Das Wattenmeer hat seinen Reiz, aber niemand baut ein Haus ins Wattenmeer. Auch das Zwielicht als Morgen- oder Abenddämmerung erzeugt reizvolle Stimmungen, aber sie verfliegen im anbrechenden Tag und der hereinbrechenden Nacht. Wir sollten nicht mit billiger Gnade trösten, da wir mit teurer Gnade erkauft worden sind. Der ständige Verweis auf die Humanwissenschaften kehrt als Bumerang zurück, wenn ihre Ergebnisse nicht in finaler Perspektive reflektiert werden. Und in Anlehnung an die olympischen Spiele in Paris: Die Spanne von Lebenswirklichkeiten zwischen Natalität und Mortalität, sollte nicht als quasi Zeitfahren gestoppt und begriffen werden, sondern als Etappen einer Tour mit einem Finale am Ende.
Dr. phil. Helmut Müller
Philosoph und Theologe, akademischer Direktor am Institut für Katholische Theologie der Universität Koblenz. Autor u.a. des Buches „Hineingenommen in die Liebe“, FE-Medien Verlag