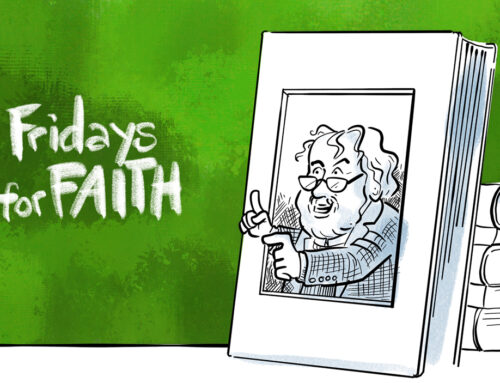Anmerkungen zum synodalen Grundtext „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“
Bei der vierten Synodalversammlung des Synodalen Weges im September 2022 wurde der Grundtext „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ (FDÄK), der für die Einführung des Frauenpriestertums in der Kirche argumentiert, mit über 91 Prozent der Stimmen angenommen. Die Zustimmung der Bischöfe lag niedriger, erreichte aber die notwendige 2/3-Mehrheit (bei zehn bischöflichen Neinstimmen und fünf Enthaltungen).
Die Frage einer möglichen Zulassung von Frauen zum Priesteramt bewegt die Kirche seit Jahrzehnten, die exegetischen, dogmatischen, pastoraltheologischen Argumente pro und contra sind bekannt, das Lehramt hat zum Thema mehrfach Stellung bezogen – mit negativem Ergebnis. Mit welchen Argumenten also votiert der Synodaltext trotzdem für eine Änderung der kirchlichen Praxis? Zehn Beispiele sollen die Argumentationsweise des Textes veranschaulichen.
1. Die Bitte um päpstliche Klärung: Ein rhetorisches Manöver
Nach Medienberichten kam eine ausreichende bischöfliche Zustimmung zum vorliegenden Text erst durch die kurzfristige Einfügung zustande, es sei „die Frage an die höchste Autorität in der Kirche (Papst und Konzil) zu richten, ob die Lehre von ‚Ordinatio Sacerdotalis‘ [= päpstliches Lehrschreiben von 1994 zur Unmöglichkeit der Frauenweihe] nicht geprüft werden muss“ und „ob die Lehre von ‚Ordinatio Sacerdotalis‘ die Kirche unfehlbar bindet oder nicht“ (FDÄK, Einleitung). Das Synodalpapier soll also als Bitte an den Papst verstanden werden, die Möglichkeit von Priesterinnen erneut zu prüfen. Ein plausibler Vorschlag? Nein, die Bitte entpuppt sich beim näheren Hinsehen als rein rhetorische Floskel.
Bereits 1976, also vor knapp 50 Jahren, hat die Glaubenskongregation in der Erklärung Inter Insigniores die theologischen Gründe zusammengefasst, warum sich die Kirche „aus Treue zum Vorbild ihres Herrn nicht dazu berechtigt [sieht], die Frauen zur Priesterweihe zuzulassen“ (Inter Insigniores, Einleitung). 1994 hat Papst Johannes Paul II. diese Position bestätigt und im Schreiben Ordinatio Sacerdotalis kraft seines päpstlichen Lehramtes festgestellt, „dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben.“ (OS 4) Damit nicht genug, seither haben sowohl Papst Benedikt XVI. als auch Papst Franziskus wieder und wieder betont, die Frage sei endgültig und definitiv entschieden.
All dessen ist sich das synodale Papier vollkommen bewusst. FDÄK 5.3 bestätigt ausdrücklich, die Kirche stufe die Lehre von der Unmöglichkeit der Frauenweihe seit 1994 als „‚definitive tenendam‘ (‚als endgültig zu bewahren‘)“ (FDÄK 5.3) ein. Man weiß, dass aus Sicht Roms die Frage der Frauenpriester bereits definitiv geklärt ist. Trotzdem fordert man eine erneute Prüfung, mit der Begründung, die Lehre werde „von einer immer größer werdenden Zahl der mit dem Glaubenssinn ausgestatteten Gläubigen in Frage gestellt oder ganz abgelehnt“. (FDÄK 5.3) Abgesehen von der eher abwegigen Vorstellung, eine definitive Lehre der Kirche unter Berufung auf den „Glaubenssinn der Gläubigen“ aushebeln zu wollen, verrät der Text mit aller wünschenswerter Klarheit die Grundhaltung, die hinter der Bitte um eine erneute Prüfung steht: Man macht keinen Hehl daraus, dass man bereit ist, eine definitive Lehre abzulehnen, wenn man selbst anderer Meinung ist. Dies ist genau die Situation seit 1994 – warum sollte es nach einer erneuten vatikanischen Klärung anders sein? Anders ausgedrückt: Solange der Papst nicht zum von Deutschland gewünschten Ergebnis kommt, sieht man sich – unter Berufung auf den eigenen Glaubenssinn – zu nichts verpflichtet. Damit entlarvt sich die Klärungsbitte an den Papst als rein rhetorisches Manöver.
2. Gal 3,28: Interessengeleitete Interpretation
Der Grundtext führt mehrmals die berühmte Stelle Gal 3,28 als Leitgedanke an: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.“ Aus dem kontextlosen Schriftzitat folgert man, im kirchlichen Umgang mit Männern und Frauen dürfe es keine Unterschiede geben. Wörtlich heißt es: „Trennungen nach Herkunft, Stand und Geschlecht sind in der Gemeinschaft, die sich zu Jesus als Christus bekennt, aufgehoben. (…) Als Frau* von der amtlichen Christusrepräsentation ausgeschlossen zu sein, ist skandalös.“ (FDÄK Einleitung)
Diese Auslegung von Gal 3,28 ist unhaltbar. Paulus betont an dieser Stelle, durch den Glauben an Christus stehe jedem Menschen der Zugang zur Erlösung offen; in den neuen Bund sind nicht nur Juden eingeladen, sondern auch Heiden; für die Gotteskindschaft spielt der Sozialstatus (Sklave oder Freier) keine Rolle, auch das Geschlecht nicht (männlich oder weiblich). Es geht hier um die grundsätzliche Zugehörigkeit zur Kirche. Paulus verneint damit in keiner Weise verschiedene Aufgaben innerhalb der Kirche. Im Gegenteil, die paulinischen Briefe betonen immer wieder, dass es unter den Gläubigen unterschiedliche Fähigkeiten und Aufgabe gibt. Keiner kann alles, jeder ist verschieden.
„Die einen hat Gott als Apostel eingesetzt, andere als Propheten, andere als Lehrer (…) Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer?“ (1 Kor 12,28ff; ähnlich in Eph 4,11f). Nicht jeder ist zum Apostel, Prophet oder Lehrer berufen. Nur unter grober Missachtung des Kontexts lässt sich Gal 3,28 als Beleg für einen unterschiedslosen Ämterzugang lesen. Das hätte man durchaus wissen können, denn schon 1976 hat das Schreiben Inter Insigniores zu genau dieser Stelle in Gal 3,28 klargestellt: „Dieser Text bezieht sich keinesfalls auf die Ämter der Kirche. Er bekräftigt nur die universelle Berufung zur Gotteskindschaft, die für alle die gleiche ist.“ (Inter Insigniores 6) Es überrascht, mit welcher Nonchalance der Synodaltext seine Gal 3,28-Interpretation im Widerspruch zum offensichtlichen Kontext formuliert.
3. Auf der Suche nach dem Willen Gottes: (K)ein Blick aufs Lehramt
In der Einleitung des synodalen Grundtexts heißt es: „Grundlegend stellt sich die Frage: Was ist der Wille Gottes im Blick auf die Teilhabe von Frauen an der amtlichen Verkündigung des Evangeliums? Wer kann aufgrund welcher Kriterien beanspruchen, auf diese Frage für alle Zeiten eine Antwort geben zu können?“ (FDÄK Einleitung) Für die Beantwortung dieser Fragen wäre der Synodale Weg nicht nötig gewesen; im bereits erwähnten Dokument Inter Insigniores von 1976 hat das kirchliche Lehramt beide Fragen ausdrücklich beantwortet.
Welcher Autorität steht es zu, diese Frage zu klären? „Es ist letztlich die Kirche, die durch die Stimme ihres Lehramtes in diesen verschiedenen Bereichen die richtige Unterscheidung zwischen den wandelbaren und den unwandelbaren Elementen [der Sakramente] gewährleistet. Wenn sie gewisse Änderungen nicht übernehmen zu können glaubt, so geschieht es deshalb, weil sie sich durch die Handlungsweise Christi gebunden weiß: ihre Haltung ist also entgegen allem Anschein nicht eine Art Archaismus, sondern Treue. (…) Diese Praxis der Kirche erhält also einen normativen Charakter: in der Tatsache, dass sie nur Männern die Priesterweihe erteilt, bewahrt sich eine Tradition, die durch die Jahrhunderte konstant geblieben und im Orient wie im Okzident allgemein anerkannt ist, stets darauf bedacht, Missbräuche sogleich zu beseitigen. Diese Norm, die sich auf das Beispiel Christi stützt, wird befolgt, weil sie als übereinstimmend mit dem Plan Gottes für seine Kirche angesehen wird.“ (Inter Insigniores 4) Niemand ist gezwungen, der Stimme des kirchlichen Lehramtes Gehör zu schenken; die kirchliche Lehre ist – wie die Erlösung überhaupt – ein Angebot Gottes an jeden Menschen. Man kann sie in Freiheit annehmen oder ablehnen. Doch die Frage nach der zuständigen Autorität zur Klärung der Möglichkeit des Frauenpriestertums ist – auch wenn man es nicht wahr haben will – seit bald 50 Jahren explizit geklärt.
Auch auf die Frage, was der diesbezügliche Wille Gottes ist, antwortet Inter Insigniores, „dass die Kirche, indem sie nur Männer zur Weihe und zum eigentlichen priesterlichen Dienst beruft, jenem Urbild des Priesteramtes treu zu bleiben sucht, das der Herr Jesus Christus gewollt und die Apostel gewissenhaft bewahrt haben.“ (Inter Insigniores 2) Christus hat ein ganz bestimmtes Priestertum gewollt, das die Kirche in Treue bewahrt hat. Der Wille Gottes bezüglich eines möglichen Frauenpriestertum liegt im Handeln Christi offen zu tage.
4. Argumentationsstrategie: Umkehrung der Beweislast
„Wer nicht beweisen kann, dass er die Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten hat, wird bestraft.“ Ein Polizist, der so argumentiert, verkehrt die Beweislast. Nicht die Autofahrer müssen ihre Unschuld beweisen, sondern der Polizist das Fehlverhalten. Im synodalen Grundtext heißt es: „Nicht die Teilhabe von Frauen an allen kirchlichen Diensten und Ämtern ist begründungspflichtig, sondern der Ausschluss von Frauen vom sakramentalen Amt.“ (FDÄK Einleitung) Ist dieses Argument schlüssig?
Wäre das Priestertum ein menschengemachtes Amt, dann wäre eine (menschengemachte) Einschränkung auf eine bestimmte Personengruppe tatsächlich begründungspflichtig. Doch kirchliche Priesteramt ist nicht von Menschen erfunden, sondern von Jesus eingesetzt und definiert. Es gründet in Jesu Wahl der zwölf Apostel, in deren Nachfolge Priester und Bischöfe bis heute stehen. Und weil Jesus nur Männer in das Zwölferkollegium berufen hat, ist das Priestertum von seinem Selbstverständnis her an das männliche Geschlecht gekoppelt. „Die Kirche hält sich aus Treue zum Vorbild ihres Herrn nicht dazu berechtigt, die Frauen zur Priesterweihe zuzulassen.“ (Inter Insigniores, Einleitung) Vor diesem Hintergrund ist die Bewahrung der Stiftung Jesu das normale und selbstverständliche, nicht seine Änderung. Wer die Änderung des Priesterverständnisses als „selbstverständlich“ behauptet, und die Beibehaltung der von Christus eingesetzten Praxis als „begründungspflichtig“ abtut, stellt die Beweislast auf den Kopf.
5. Entwicklung des Apostelbegriff: Missachtung des biblischen Befunds
Das Synodalpapier argumentiert, der Apostelbegriff habe ursprünglich einen weiten Kreis von Jüngern und Jüngerinnen gemeint, der später von den Evangelien (vor allem in der „späteren Perspektive des Matthäus und insbesondere des Lukas“) auf den 12er-Kreis eingeschränkt worden sei. Wörtlich: „Die Evangelisten Matthäus und Lukas setzen die Apostel mit den Zwölf in eins (vgl. Mt 10,2; Lk 6,13). Für die Apostelgeschichte des Lukas entsteht mit „den Aposteln“ auf diese Weise eine einheitliche Gruppe“ (FDÄK 3.4). Damit habe man Frauen vom Apostelsein ausgeschlossen – und damit von möglichen Kirchenämtern. Eine Rückkehr zum „ursprünglichen“ Apostelbegriff würde Frauenpriester rechtfertigen.
Richtig daran ist, dass in den paulinischen Briefen der Apostelbegriff tatsächlich nicht auf das Zwölfer-Kollegium beschränkt ist. Paulus bezeichnet sowohl sich selbst als Apostel (Röm 1,1), als auch beispielsweise Andronikus und Junia (vgl. Röm 16,7). Doch die Behauptung, die späteren NT-Texte hätten den ursprünglich weiten Apostelbegriff auf das männliche Kollegium der „12 Apostel“ eingeschränkt, ist erfunden. Man muss nur die Texte des NTs lesen. In der späteren Apostelgeschichte meint der Apostelbegriff oft das Zwölferkollegium, ja. Doch genauso richtig ist, dass in eben dieser Apostelgeschichte bei der ersten Missionsreise Paulus und seine Gefährten Apostel genannt werden (vgl. Apg 14). Auch das Lukasevangelium verwendet mit „Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden“ offensichtlich einen weiten Apostelbegriff (Lk 11,49). Und umgekehrt meint Paulus in seinen frühen Briefen mit „Apostel“ manchmal direkt die Zwölf (z.B. Gal 1,17.19). Die Texte des NT sind viel weniger einheitlich, als der Synodaltext für seine Entwicklungsthese behauptet.
Besonders skurril ist in diesem Zusammenhang der Hinweis auf Maria von Magdala als „apostola apostolorum“, ein Ehrentitel, der „ihr schon bei den lateinischen Kirchenvätern“ (FDÄK 3.4) zuerkannt wurde (nämlich von Hippolyt von Rom im 3. Jahrhundert). Skurril daran ist nicht nur, dass ein 200 Jahre späteres Zeugnis für das ursprüngliche Verständnis des Apostelbegriffs nichts beitragen kann, sondern man hat übersehen, dass der Hinweis die eigene Argumentation direkt widerlegt, nämlich dass der weite paulinische Apostelbegriff schon bald auf das 12er-Kollegium eingeengt worden sei. Die Rede von der „apostola apostolorum“ beweist gerade, dass der weite Apostelbegriff selbst nach 200 Jahren noch gebräuchlich war.
Fazit: Eine spätere Einengung des Apostelbegriffs auf das rein männliche Zwölferkollegium gab es nicht. Sie wird vom synodalen Grundtext behauptet, um im Umkehrschluss die Zulassung von Frauen zum Priesteramt zu fordern. Was man dabei völlig übersieht: Die Unmöglichkeit von Priesterinnen wurde nie bloß sprachlich mit dem Apostelbegriff begründet (der in der Urkirche tatsächlich nicht einheitlich war), sondern durch die Tatsache, dass sich das Priesteramt in der Nachfolge „der Zwölf“ sah. Dass in der Urkirche über „die Zwölf“ hinaus ein größerer Kreis als Apostel bezeichnet wurde, ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus ausschließlich Männer in das Zwölferkollegium berufen hat.
6. Können Frauen Männer repräsentieren? Ja und nein zugleich
Die Kirche begründet den Ausschluss von Frauen vom Priesteramt unter anderem mit dem Argument, dass der Priester in der Eucharistiefeier Christus „repräsentiert“ und „in persona Christi“ handelt. Dies setzt eine „natürliche Ähnlichkeit“ zwischen Priester und Christus voraus. Diese notwendige Ähnlichkeit fehlt, wenn „die Stelle Christi dabei nicht von einem Mann vertreten wird: andernfalls würde man in ihm nur schwerlich das Abbild Christi erblicken. Christus selbst war und bleibt nämlich ein Mann.“ (Inter Insigniores 5) Dieses Argument lehnt der synodale Grundtext mit einer rhetorischen Frage ab: „Es drängt sich die Frage auf: Soll es wirklich das Mannsein des Amtsträgers, seine körperliche Physis sein, die ihn qualifiziert, Jesus Christus in der Feier der Eucharistie angemessen zu repräsentieren?“ (FDÄK 5.2)
Tatsächlich gibt sich der Grundtext an anderer Stelle selbst eine Antwort, wenngleich wohl ungewollt. Zur Thematik, warum Jesus nur Männer in das Zwölfer-Kollegiums berufen hat, erklärt man: „Diese Zwölf weisen auf die zwölf Stämme Israels hin und damit auf den Anspruch Jesu, das neue Israel zu sammeln (vgl. Lk 22,28–30; Mt 19,28). Da die Begründer der zwölf Stämme Israels (…) männlich waren, konnten auch die zeichenhaft berufenen Repräsentanten des neuen Israels nur männlich sein, andernfalls wäre das Zeichen nicht verstanden worden.“ (FDÄK 3.4) Jesus habe also Männer als Apostel ausgewählt, um sie als Repräsentanten der zwölf Stammvätern Israels sichtbar zu machen. So weit so gut. Damit verwendet der Grundtext in diesem Zusammenhang dasselbe Argument, das er im Kontext der Repräsentation Jesu durch die Priester ablehnt. Im obigen Zitat wurde ironisch gefragt, ob denn etwa für die Repräsentation Christi das biologische Mannsein notwendig sein könne, seine „körperliche Physis“ (ein redundanter Ausdruck, der verschleiert, dass Geschlecht mehr ist als bloße Physis). Jetzt dagegen argumentiert man, Jesus habe zwölf Männer als Apostel berufen müssen, weil nur sie mit ihrer entsprechenden „körperlichen Physis“ als Repräsentanten der zwölf Stammväter Israels verstanden werden konnten. Damit bestätigt man ausdrücklich, dass in der Ähnlichkeit der „körperlichen Physis“ eine wesentliche Voraussetzung für mögliche Repräsentation liegt. Es ist ein Widerspruch, an der einen Stelle mit der Notwendigkeit einer „natürlichen Ähnlichkeit“ zu argumentieren und an anderer Stelle genau dieses Argument abzulehnen.
Zwei Anmerkungen:
(1) Die These, die Entscheidung Jesu für die männliche Apostelwahl sei einzig der 12-Stammväter-Repräsentation geschuldet, war schon vor 50 Jahren bekannt und wurde bereits in Inter Insigniores behandelt (vgl. Endnote 10). Der Synodaltext recycelt hier lediglich ein altes Argument, ohne die Stellungnahme des Lehramts dazu auch nur zu erwähnen.
(2) Der Synodaltext wirft noch folgende Frage auf: „Wenn die Möglichkeit der Christusrepräsentanz bei der Taufspendung nicht an das männliche Geschlecht gebunden ist, warum sollte sie es beim Eucharistievorsitz sein?“ (FDÄK 5.2) Alle Sakramente werden in persona Christi gefeiert, immer handelt Jesus, vermittelt durch den Spender. Wegen der Repräsentation Christi sind darum die geweihten Amtsträger die „regulären“ Spender der Sakramente. Nur im Notfall kennt die Kirche bei der Taufe eine Ausnahme. Nie jedoch bei der Eucharistie, denn hier wirkt Jesus nicht nur durch Zeichen, sondern ist substantiell gegenwärtig und schenkt sich selbst. „Das ist mein Leib“. Bei keinem anderen Sakrament ist dies der Fall. Darum ist bei der Eucharistie die Verbindung von Jesus und dem sakramentalen Repräsentant nochmals wesentlich enger.
7. Die Rolle der Frau in der Urkirche: Missbrauch von Nebensätzen
In Bezug auf die biblischen Zeugnisse zur Rolle der Frau in der Urkirche fasst der synodale Grundtext zusammen: „Die zahlreich und namentlich bezeugten Frauen mit ihren Funktionen und Aufgaben in den Gemeinden ergeben ein eindrucksvolles [!] Bild: Frauen waren, in gleicher Weise [!] und zusammen mit den Männern, in Angelegenheiten der Gemeindeleitung [!] wie der Gemeindeorganisation [!] tätig.“ Erkennbar in den NT-Zeugnissen seien „Schlüssel- und Leitungsrollen, die in der konkreten Praxis wahrscheinlich meist [!] die jeweiligen Hausvorstände innehatten und in denen uns einige Frauennamen überliefert sind“ (FDÄK 3.5). Anschließend bringt der Text eine längere Namensliste, die beinahe alle Frauen anführt, die irgendwo in einem Paulusbrief erwähnt sind. So genügt z.B. der Vers „Grüßt Philologus und Julia“ in Röm 16,15, um Julia, von der sonst nichts bekannt ist, in die Liste weiblicher Hausvorstände (mit vermuteter Leitungsfunktionen in der Urgemeinde) aufzunehmen. Gleiches gilt für die Schwester des Nereus, von der nicht einmal der Name bekannt ist. Ja, es gab Frauen, in deren Haus die Gemeinde zusammenkam, z.B. die Mutter des Johannes Markus (vgl. Apg 12,12) oder Lydia in Philippi (vgl Apg 16,15ff); vom Haus der Priscilla weiß man zwar nichts, aber ihr Name wird von Paulus mehrfach erwähnt. Doch in allen Fällen bleibt gänzlich unklar, ob diese Frauen „in gleicher Weise“ wie die männlichen Jünger mit den „Angelegenheiten der Gemeindeleitung wie der Gemeindeorganisation“ betraut waren. Dafür gibt es im NT einfach keine Hinweise. In Bezug auf die Leitung der Eucharistiefeier räumt dies der Handlungstext dann auch bereitwillig ein: Paulus verwende keinen bestimmten Begriff für die Leitung des Herrenmahls, „weder für Männer noch für Frauen“ (FDÄK 3.5). Diese Beobachtung wird dann freilich seinerseits als Indiz gedeutet, es könnten damit also sehr wohl auch Frauen betraut gewesen sein. Ähnlich argumentiert man bei den männlichen Amtsbezeichnungen: Weil Paulus grundsätzlich in „männerzentrierter Sprache“ schreibt, „ist nicht auszuschließen“, dass mit den „in Phil 1,1 erwähnten Episkopen und Diakonen konkrete Frauen mitgemeint sind“ (FDÄK 3.5) – dabei ist an keiner (!) einzigen Entscheidungssituation der Urgemeinde, die das NT berichtet, eine Beteiligung von Frauen erwähnt (vgl. Apostelwahl des Matthias in Apg 1, Wahl der ersten Diakone in Apg 6, Aussendung zur ersten Missionsreise in Apg 13, Apostelkonzil in Apg 15 usw.).
Die Argumentationsstrategie wiederholt sich immer wieder: Weil die NT-Texte zur Rolle der Frauen schweigsam und vage sind, lassen sich kühne Hypothesen formulieren, die dann als „möglich“, „nicht auszuschließen“ oder „wahrscheinlich meistens“ präsentiert werden – und flugs ist „bewiesen“, dass Männer und Frauen in der Urkirche „in gleicher Weise“ mit der Gemeindeleitung betraut waren. Seriöses Argumentieren sieht anders aus.
8. Zurückdrängung der Frauen: Fehlende Textbasis
Nach FDÄK 3.5 wird die Gleichberechtigung der Frauen in den ersten christlichen Gemeinden vor allem in den frühen Paulusbriefen sichtbar, wo jeder Gläubige sein eigenes Charisma ausüben konnte. In den Evangelien, vor allem beim dritten Synoptiker Lukas und in der Apostelgeschichte, würden Frauen immer mehr zugunsten der männlichen Apostel zurückgedrängt. In den späten Pastoralbriefen seien Frauen schließlich von Ämtern ausgeschlossen, den vielfältigen Charismen weiche die Amtsgnade, die Männern vorbehalten sei. „Je mehr die Institutionalisierung voranschritt, desto stärker traten Frauen in den Hintergrund.“ (FDÄK 3.5) Die Praxis der ersten Gemeinden dagegen würde Frauenämter rechtfertigen.
Die These hält einer kritischen Überprüfung anhand der biblischen Texte nicht stand. Es gibt keinen Evangelisten, der Frauen so sehr in den Mittelpunkt stellt wie der gescholten Lukas. An einer Stelle sieht sich der Handlungstext selbst genötigt zuzugeben, dass das Lukasevangelium „in der Forschung (…) als ‚das Evangelium der Frauen‘ [gilt], weil es viele Frauen namentlich hervorhebt und als einziges ausführt, dass auch Frauen Jesus auf seinen Verkündigungsreisen in Galiläa nachgefolgt sind (Lk 8,1-3).“ (FDÄK 3.5) Doch Lukas werte Frauen stets ab und stelle sie nur als Unterstützer Jesu dar, statt als gesandte Jünger. „Aus Frauen wie Maria von Magdala, die bei Jesus eine Sendung der Verkündigung hatten, werden bei Lukas Unterstützerinnen und Dienerinnen der männlichen Verkünder.“ (FDÄK 3.5) So die Behauptung. Doch der biblische Text zeigt etwas anderes. Auch in Lukas werden Maria von Magdala und die Frauen mit der Osterbotschaft zu den Aposteln gesandt (vgl. Lk 24,10). Noch mehr: Maria von Magdalas Sendung zu den Jüngern durch Jesus persönlich wird nur im letzten Evangelium berichtet (Joh 20,1ff) und im nachträglich angefügten zweiten Schluss bei Markus (Mk 16,9f). Exegetisch ergibt sich also das genaue Gegenteil: Erst die späten Evangelientexte unterstreichen die besondere Rolle Maria von Magdalas als von Jesus gesandte Verkünderin. Dem vorgebrachten Argumentation fehlt die Textbasis.
Über die späten Pastoralbriefe heißt es im Synodaltext: „Die Frauen werden aus der öffentlichen Gemeinde ausgeschlossen und in den Bereich des Hauses zurückgedrängt.“ (FDÄK 3.5) Als Begründung wird z.B. auf 1 Tim 2,11ff verwiesen, wo Frauen der öffentliche Lehrunterricht in der Gemeinde untersagt wird. Dasselbe Verbot findet sich freilich bereits in 1 Kor 14,34f, einem frühen Paulusbrief – womit es als Indiz für eine nachträgliche Zurückdrängung der Frauen wertlos ist. (Der Synodaltext will die Problematik mit dem Hinweis lösen, „einige Forscher“ hielten 1 Kor 14,34f für eine nachträgliche Einfügung in den Originaltext; allerdings gibt es dazu keinen Konsens unter Exegeten.) Der behaupteten Zurückdrängung der Frauen widerspricht außerdem, dass in den Grußlisten der späten Pastoralbriefe immer wieder Frauen erwähnt werden – genauso wie in den frühen Paulusbriefen, z.B. Prisca in 2 Tim 3,19 oder Claudia in 2 Tim 3,21. In 2 Tim 1,5 wird der aufrichtige Glaube von Loïs und Eunike gelobt. Dabei ist unerheblich, dass die historische Existenz dieser Frauen von manchen Exegeten bezweifelt wird. Selbst wenn die Namen nachträglich erfunden wären, zeigen die Stellen, wie wichtig die Nennung von Frauengestalten auch in späterer Zeit war. Die These der vermeintlichen Zurückdrängung von Frauen nach den ersten Jahren der Urgemeinde gerät in Widerspruch zum tatsächlichen Textbefund.
9. Umgang mit Berufungen zum Frauenpriestertum: Längst geklärt
Für den Synodaltext ist klar: „Über die Ämtervergabe darf künftig nicht mehr das Geschlecht entscheiden, sondern die Berufung“. (FDÄK 5.2) Was also tun, wenn Frauen sich zum Priester berufen fühlen? „Nicht wenige Frauen erfahren sich von Gott zur Teilhabe an sakramentalen Diensten und Ämtern berufen. (…) Die von der kirchlichen Lehre verordnete Einschränkung ihrer Lebens- und Berufungsmöglichkeiten empfinden sie als Unrecht, als Diskriminierung und Ausgrenzung. Über das Erleben einer existenziellen Begegnung mit Gott hat niemand zu urteilen.“ (FDÄK 5.2)
Mit dem Phänomen von subjektiv erlebter Priesterberufung von Frauen hat sich die Kirche bereits in Inter Insigniores beschäftigt. Warum greift der Synodaltext nicht auf diese Überlegungen zurück? Das vatikanische Schreiben war sich 1976 durchaus bewusst, „dass einige Frauen in sich eine Berufung zum Priestertum verspüren. Ein solches Empfinden, so edel und verständlich es auch sein mag, stellt noch keine Berufung dar. Diese lässt sich nämlich nicht auf eine persönliche Neigung reduzieren, die rein subjektiv bleiben könnte. Da das Priestertum ein besonderes Amt ist, von dem die Kirche die Verantwortung und Verwaltung empfangen hat, ist hier die Bestätigung durch die Kirche unerlässlich: diese bildet einen wesentlichen Bestandteil der Berufung; denn Christus erwählte die, »die er wollte« (Mk 3, 13). (…) Die Frauen, die für sich das Priesteramt erbitten, sind sicher von dem Wunsch beseelt, Christus und der Kirche zu dienen. Und es überrascht nicht, dass in dem Augenblick, da die Frauen der Diskriminierungen bewusst werden, denen sie bisher ausgesetzt gewesen sind, einige von ihnen dazu veranlasst werden, sogar das Priesteramt für sich zu erstreben. Man darf jedoch nicht vergessen, dass das Priestertum nicht zu den Rechten der menschlichen Person gehört, sondern sich aus der Ökonomie des Geheimnisses Christi und der Kirche herleitet. Die Sendung des Priesters ist keine Funktion, die man zur Hebung seiner sozialen Stellung erlangen könnte. Kein rein menschlicher Fortschritt der Gesellschaft oder der menschlichen Person kann von sich aus den Zugang dazu eröffnen, da diese Sendung einer anderen Ordnung angehört.“ (Inter Insigniores 6) Es bleibt unverständlich, warum der Synodale Text auf diese ausführliche Stellungnahme des Lehramts zur subjektiv empfundenen Berufung von Frauen nicht zurückgreift.
10. Last but not least: Ein inkonsistentes Genderkonzept
Das Grundpapier legt Wert darauf, Geschlecht „mehrdimensional“ zu verstehen. Als Gender sei das Geschlecht „das Ergebnis eines gesellschaftlichen Prozesses“; „die Frage nach der Zweigeschlechtlichkeit“ sei heute „mit neuer Sensibilität zu stellen“. Keinesfalls könne zwischen Mann und Frau eine „Differenz wesenhaft begründet“ werden. Bei der Ämterverteilung bedürfe es einer „geschlechtsunabhängigen Wahrnehmung aller Funktionen, Ämter und Berufe in der Gesellschaft wie auch in der Kirche. Rollenzuschreibungen im Rahmen einer auf das vermeintlich natürliche Wesen der Geschlechter hin orientierten Polarität werden in der heutigen Gesellschaft vielfach sehr kritisch angefragt.“ (FDÄK 2.2)
Es ist hier nicht der Ort, dieses Konzept von Gender näher zu diskutieren. Wer davon ausgeht, dass es keine wesenhafte Grundlage für die Geschlechterdifferenz gibt, sondern Geschlechtsrollen nur soziokulturell bedingt sind, wird völlig konsequent eine geschlechtsunabhängige Ämterverteilung fordern.
In einem eklatanten logischen Widerspruch zu diesem Verständnis von Gender steht dann freilich der Begründungsansatz des gesamten übrigen Papiers. Das Grundargument des Synodaltextes lautet ja: Ausgehend von der historischen Rekonstruktion der Rolle der Frau in der ersten Christengeneration lassen sich Folgerungen für die Rolle der Frau in heutiger Zeit ableiten. Aus Sicht eines „traditionellen“ Geschlechterverständnisses, das eine wesentliche Differenz von Mann und Frau akzeptiert, mag diese Argumentationsfigur prinzipiell schlüssig sein; dann lässt sich sinnvoll erforschen, ob Vertreter des weiblichen Geschlechts irgendwann, irgendwo, irgendwelche kirchlichen Leitungsaufgaben innehatten, und was daraus heute für Frauen folgt. Wenn dagegen Gender und weibliche Rollenbilder als Ergebnis von soziokulturellen Prozessen entlarvt sind, dann ist es vollkommen unerheblich, ob in der Urkirche „Frauen“ (d.h. Glaubende, die sich nach damaligen soziokulturellen Vorstellungen weiblichen Rollenmustern verpflichtet sahen) in kirchlichen Ämtern tätig waren oder nicht. Wenn Gender ein soziokulturelles Konstrukt ist, verlieren geschichtliche Argumente aus Rollenverständnissen vergangener Zeiten schlicht ihre Relevanz. Mehr noch: Sie unterlaufen das eigene Gendermodell, sofern sie die biologische Differenz der Geschlechter als wesentliches Kriterium voraussetzen, sich argumentativ auf diese Differenz beziehen und sie damit als zentrales Kriterium ihrerseits affirmieren.
An manchen Stellen scheint sich der Text einem Bewusstsein für diese Problematik anzunähern, z.B. wenn man bemerkt, „dass das, was wir über konkrete Frauen und ihre Möglichkeiten wie über die Grenzen ihrer Partizipation in urchristlichen Gemeinden wissen, immer auch abhängig ist von den konkreten gesellschaftlichen Vorstellungen, in erster Linie von den vorherrschenden Rollenbildern für Männer und Frauen, denen die christlichen Minderheiten sich anpassten.“ (FDÄK 3.6) Die logische Folgerung, dass sich also – wenn man moderne Gendertheorien ernstnimmt – aus historischen Beobachtungen damaliger Geschlechterrollen nichts ableiten lässt und folglich die Argumentation der Abschnitte über biblische Grundlegung (Kap. 3) und Traditionsgeschichte (Kap. 4) – also ein Großteil der theologischen Argumentation des Papiers – im Widerspruch zum propagierten Gendermodell steht, wird geflissentlich übersehen bzw. ausgeblendet.
Man muss sich zwischen der historischen-theologischen Argumentation für Frauenpriester und dem modernen Gendermodell entscheiden. Man kann nicht beides zusammen ernst nehmen. Dass im Synodaltext beides vertreten wird – scheinbar ernst gemeint –, stellt den gesamten Text in Frage.
—
Im September 2019, drei Jahre vor der Verabschiedung des Grundtextes, hatte sich die Wiener Theologin Prof. Marianne Schlosser aus dem Frauen-Arbeitsforum des Synodalen Weges zurückgezogen, mit der Begründung, alle Arbeiten der Arbeitsgruppe seien geprägt von einer „interessengeleitete[n] Fixierung auf das Weihesakrament“. Jetzt, nachdem die finale Fassung des Papiers von der Synodalversammlung angenommen wurde, zeigt sich, wie richtig Schlosser mit ihrer Einschätzung lag. Der Text erweckt den Eindruck, dass die Forderung der Frauenweihe nicht das Endergebnis der theologischen Argumente, sondern ihr Apriori ist. Jedes Argument scheint unter dieser Prämisse formuliert. Dafür werden biblische Fakten willkürlich interpretiert, Begründungen des kirchlichen Lehramtes leichtfertig ignoriert, argumentative Widersprüche großzügig akzeptiert. Bernhard Meuser, Publizist und Herausgeber des Youcat, hat die Synodaltexte etwas patzig als „lausige Theologie“ bezeichnet (DT 04.11.2022). Ganz unrecht hat er wohl nicht.
P. Markus Christoph
ist Mitglied der Ordensgemeinschaft der Servi Jesu et Mariae (SJM) und als Dozent im Studienhaus Petrus-Canisius in Blindenmarkt tätig.