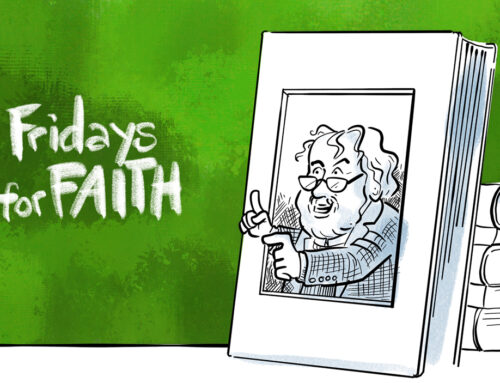Saskia Wendel hat einen philosophischen Berg zum Kreißen gebracht, um eine erbärmliche theologische Maus zu gebären, schreibt Helmut Müller in seiner Rezension ihres Buches „In Freiheit glauben“. Er will mit dem Text aufzeigen, wohin eine solche Theologie die Kirche und ihre Glaubenden in Deutschland führt, in der Hoffnung, das Elend, das wir gegenwärtig in ihr vorfinden, somit verständlich zu machen. Eine Rezension von Dr. Helmut Müller zu Saskia Wendels Buch: „In Freiheit glauben. Grundzüge eines libertarischen Verständnisses von Glauben und Offenbarung.“, Regensburg 2020.
Das hier zu rezensierende Buch irritiert. Es macht dem Rezensenten Bauchschmerzen: Wie geht man damit um, wenn eine durchaus zu konstatierende Scharfsinnigkeit völlig und katastrophal in die Irre führt? Aus der Rezension ist daher eine Glosse geworden, in der Sprache drastisch, aufrüttelnd. Sie soll zeigen und deutlich machen, wohin eine solche Theologie die Kirche in Deutschland und die in ihr noch Glaubenden hingeführt hat und hinführen wird, wenn sie sich eine solche Theologie zu eigen macht. Vielleicht wird das Elend, das wir gegenwärtig in ihr vorfinden, so verständlich.
Man wird mir Alarmismus vorwerfen, aber ich will nichts anderes, als tatsächlich Alarm schlagen. Die Fragen, die hier zur Debatte stehen, mögen im ersten Augenblick abstrakt wirken und abgehoben. In Wirklichkeit ist es die entscheidende Grundfrage unseres Lebens: Was heißt es, ein Geschöpf zu sein, dem Gott Freiheit geschenkt hat?
Saskia Wendel sagt: Das sei die göttliche Gabe, auch gottlos zu leben, wenn ich das will. Der christliche Glaube sagt: Der Gott, der frei liebt, ringt um die freie Liebe seiner Geschöpfe. Er will unser „Ja“ und an diesem „Ja“ hängen Sinn oder Unsinn unseres Menschseins.
„In Freiheit glauben“. Eigentlich ist der Titel schon eine Irreführung. Richtigerweise müsste das Buch „An Freiheit glauben“ heißen. Das libertarische Verständnis von Freiheit meint nämlich „Freiheit bestimmt ihre Inhalte selbst“ (K. H. Menke). Nichts anderes wird auch im Buch thematisiert. Begriffe wie „Natur“, „Schöpfung“, “Liebe“, ja selbst „Gott“ werden aus einem möglichen Bestimmungsfeld, in dem Freiheit eine objektive Orientierung erfahren könnte, aussortiert. Sie werden wie Computerviren behandelt, die von einem Virenscanner in die Quarantäne geschoben werden, damit sie das im Buch thematisierte libertarische Freiheitsverständnis in seinem Aktionsradius nicht begrenzen und stören können.
„Natur“ als Störenfried libertarisch verstandener Freiheit
Zunächst zur „Natur“. Sie wird entsorgt, indem sie wie in der Determinismusdebatte (13ff) nur kausalmechanisch als causa efficiens und damit unterkomplex behandelt wird. Dass sie auch natürliche Ziele enthalten könnte (causa finalis), wie sie Hans Jonas[1] und Robert Spaemann[2] vor Jahren schon in die Diskussion gebracht haben, wird gar nicht beachtet.
Die neuere semiotische Theorie des Lebendigen kennt Wendel offenbar nicht. Die schon in der französischen Revolution proklamierte Göttin Vernunft und die von Wendel ähnlich verehrte Freiheit werden unübersehbar zu Maîtresses de la nature, übrigens eine zeitgemäße Feminisierung des Maitre de la nature von Descartes. Saskia Wendel strebt offenbar an, Hohepriesterin dieses neuen Kultes um die Freiheit zu werden. Schon Goethe fragte sich, ob die der menschlichen Vernunft und Freiheit ausgesetzte Natur in den Experimenten mit ihr auch wirklich sage, was sie sei.
Der Mensch, ein Gott-Avatar in der „Welt unter dem Monde“ (Aristoteles)
Die „Schöpfung“: Sie ist die theologische Version von Natur. Der Schöpfer hat offenbar sein Geschöpf mit einer solch kompetenten Vernunft ausgestattet, dass es im Laufe der Geschichte in der Kenntnis der Natur soweit vorangekommen ist, dass es regelrecht zu einem Gott-Avatar („gottbildlich“, S. 94), mutiert ist und die Schöpfung sogar verbessert, indem es etwa mit der Zweigeschlechtlichkeit Schluss macht und neue Geschlechter erfindet. Gott – in seiner Festlegung auf Zweigeschlechtlichkeit – wirkt geradezu wie ein Einfaltspinsel, während sein Avatar offenbar fähig ist, immer mehr Geschlechter zu erfinden.
Mit der Verschiebung von „Schöpfung“ in die Quarantäne ist die übrig gebliebene, final entmächtigte Natur, dem Geschöpf mit seinem libertarischen Freiheitsverständnis gnadenlos preisgegeben. In diesem Refugium gilt-statt der Richtlinienkompetenz des Schöpfers – nur noch die diskursive Vernunft des Geschöpfes, das nur noch in Konkurrenz steht mit der Vernünftigkeit seinesgleichen. Das binäre Konzept der Geschlechtlichkeit des Schöpfers wirkt dagegen schlicht einfältig, wo die Vernunft des Geschöpfes doch in manchen Gefilden schon bei 60 Geschlechtern oder gar mehr angelangt ist!
Vom Gott im Sturm bei Jeremia zum lauen Lüftchen in libertarischer Freiheitstheologie
Als Theologin kann Wendel jetzt natürlich „Gott“ nicht so in Quarantäne schieben wie „Natur“ und „Schöpfung“. Geschickt nutzt sie die philosophisch/theologische Tradition ab Duns Scotus (S. 103), Gott in seinem Weltbezug nach und nach zu vernebeln oder in die Nichterkennbarkeit zu verschieben. Um Gott für die Belange der libertarischen Freiheit unschädlich zu machen, muss er möglichst freundlich umdefiniert werden.
So wird Gott mehr und mehr zum Sozialfall des Universums, wohnsitz- und arbeitslos. Das beginnt zwar damit, dass das Geschöpf Freiheit von diesem Gott als Gabe noch empfängt (S. 21), aber selbstverständlich ohne jede Gebrauchsanweisung, wie mit dieser Gabe umzugehen ist. Nur die Vernunft des Geschöpfs besitzt die Richtlinienkompetenz dieser Freiheit. Aus den „unerhört findigen Tieren“ Karl Rahners, die wir wären ohne Gott, werden wir zu „gottbildlichen“ Menschen mit Gott: Der Gott des Alten Testamentes der noch „im Sturmwind daher fährt“ (Jer. 4,13) und auch im neuen Testament noch „auf den Wolken des Himmels“ (Mt. 24, 30) erwartet wird, scheint irgendwie zum lauen Lüftchen verkommen zu sein.
Er hat offenbar die Einladung angenommen, sich auf Augenhöhe mit seinem Geschöpf zu begeben. Er scheint nämlich die libertarische Freiheit seines Geschöpfes so sehr zu lieben, dass er sich den Entscheidungen seines Geschöpfes fügen will. Da passen natürlich Begriffe des agnostischen Philosophen Peter Sloterdijk wunderbar: „Frei Glaubende sind keine Vasallen eines göttlichen Herrn, keine ´Seinsbeamte(n)´ […] keine Untertanen eines omnipotenten Souveräns, von denen Glauben eingefordert wird“ (S. 143).
In aufrechter Haltung glauben – nicht mehr auf den Knien
Der Glaubende – der wohl an nichts anderes mehr, als an seine Freiheit glaubt – sollte dies „in aufrechter Haltung und nicht auf Knien tun.“ (ebd.) Alles andere sind anthropomorphe Gottesvorstellungen (S. 20, 97, 137, 143). „Offenbarung“ passt dann natürlich auch nicht mehr ins theologische Weltbild, da das Geschöpf mittlerweile ja schon alles weiß. Offenbarung von woanders her, als aus dem Geschöpf selbst, könnte ja die „selbstursprüngliche Freiheit“, die offenbar nur für Altgläubige noch als „Gabe“ getarnt wurde, logisch nur verunklären. Wendel stellt daher auch konsequent die Frage, ob nicht der „Offenbarungsbegriff gänzlich preiszugeben“ (S. 143) sei.
Die Frage ist rhetorisch, da Wendel dann doch wieder einige Altgläubige im Sinn hat. Gott kann sich also weiter offenbaren. Die Offenbarungen sind ja sowieso unschädlich (was er über den Wolken macht, interessiert sie als Fundamentaltheologin nicht, das sollte ihre Kollegin Johanna Rahner in Tübingen aber interessieren), weil die Offenbarungen wohl darin bestehen, wie sie schreibt, dass das Geschöpf: „…frei, frei dazu [ist], selbst einen Anfang zu setzen, Neues hervorzubringen, Überzeugungen, Normen, Werte, Strukturen, auch religiöse Überzeugungen“ (S. 142). Gott wird so zum berühmten Rad bei dessen Drehung sich nichts mit dreht. Gott kann dann über den Wolken – frei nach Reinhard Mey – machen was er will, wenn er nur seinen gottbildlichen Avatar auf Erden ebenso frei schalten und walten lässt.
Fordernde, ethisch aufgeladene Liebe, stört fundamentaltheologische Überlegungen
Es bleibt also nur noch die „Liebe“, die an – wer weiß was – ketten kann. Wendel kommt nicht in den Sinn – Liebe, den Leib einbeziehend – mit Begehren zu verbinden, obwohl sie in einer langen Auseinandersetzung – „Freiheit unterwandert von Begehren?“ (S. 45 – 50) darüber reflektiert. Letzten Endes obsiegt auch hier Freiheit.
Christlich ist Liebe immer mit Hingabe verbunden, wenn nicht sogar mit Preisgabe. Christus hat es uns vorgemacht: Er hat unsere Gestalt angenommen, nicht um seine Schöpfung touristisch zu bereisen vom Korallenriff bis zum Mount Everest, sondern bis in die Niederungen, wo es wehtut, zu leben, diese Not mit uns zu teilen und uns schließlich aus dieser Pein zu erlösen. Das ist die Vorgabe für uns. Davon ist bei Wendel nichts zu finden, im Gegenteil: Sie grenzt sich von diesen Gedanken sowohl von Pröpper (S. 195, Anm. 188) als auch von Rahner (S. 100, Anm. 196) ab, weil Liebe ethisch aufgeladen sei.
Ihr kommt es nur darauf an, sich kontingent dem Schöpfer zu verdanken – und so von ihm zu unterscheiden – dann „gottbildlich“ dessen Freiheit selbstursprünglich im Schöpfungsakt empfangen zu haben. Um letzteres zu erweisen, hat sie nach allen Regeln philosophischer Kunst und sehr kompetent die neuzeitliche Freiheitsgeschichte penibel unter die Lupe genommen, um dort ihren Freiheitsbegriff zu verankern und herzuleiten und liest diesen in die neuere Theologie hinein, was nicht sonderlich schwer ist, da es jede Menge Wegbereiter gibt, ohne sich die Mühe zu machen, ihn auch aus Schrift und Tradition herzuleiten, was so gar nicht möglich gewesen wäre, weil o. g. „Viren“ das verhindert hätten.
Ein Denkgerüst für philosophische Hochgebirgsregionen jenseits der Baumgrenze
Saskia Wendel bewegt sich in philosophischen Hochgebirgsregionen jenseits der Baumgrenze, wo ihr niemand mehr ohne entsprechende Ausrüstung begegnet und sich bewegen kann. Obwohl man früher Gott gerade auf Bergen verehrte, begegnet man ihm in diesen philosophischen Höhenlagen – gemessen an dem, was der Fleisch gewordene Gott für uns ist – nur noch als Berggeist. Beim Lesen hat man sogar den Eindruck, dass man ihm nicht begegnen will – nicht als Souverän, nicht als dem Allwissenden, nicht als dem Allmächtigen, nicht als dem Allgütigen, und schon gar nicht als dem „Vater“.
Jedenfalls will Saskia Wendel ihn auf gar keinen Fall anthropomorph verstehen, wie ihn etwa der große evangelische Theologe Helmut Thielicke noch verstand. Als derjenige, von dem sich ein Kind „einen Ballonroller wünscht“, oder dass er doch wenigstens in dem Boot schlafen möge, mit dem man in den Stürmen des Lebens selbst in Bedrängnis geraten ist und ihn nur zu wecken braucht, wie damals die Jünger auf dem See Genezareth. Man fragt sich: Warum ist er nicht einfach Geist geblieben? Das war er doch schon bei den alten Griechen – und wurde es wieder über Duns Scotus, Kant und Fichte, um schließlich auf die Höhe der Zeit zu kommen bei Magnus Striet und ihr selbst.
Warum musste er sich wie wir unter Schmerzen durch einen engen Geburtskanal quälen, als Migrantenkind auf die Welt kommen, um Fleisch zu werden? Ist er vielleicht Masochist, weil er sich in die Knochenmühle der Welt begeben hat und als Schwerverbrecher am Kreuz, dem Galgen der Antike endete, nur um uns die Gabe der Freiheit zu bringen? Diese hat Wendel doch ohne ihn bei Kant, Fichte und Foucault entdeckt, eine Gabe, der sie ihre ganze Geisteskraft geopfert hat, die sie wie einen Götzen verehrt?
Wie sich philosophischer Scharfsinn in theologischen Schwachsinn verwandelt
Saskia Wendel hat einen philosophischen Berg zum Kreißen gebracht, um eine erbärmliche theologische Maus zu gebären. Sie hat mit philosophischem Scharfsinn nicht nur à la Ockham, der Metaphysik den Bart abrasiert; sie hat in das Fleisch des menschlichen Geistes geschnitten. Charles Taylor spricht von der „Minusvernunft“ der Moderne, die nicht mehr zu großen theologischen Gedanken fähig ist. So verhilft man mit philosophischem Scharfsinn theologischem Schwachsinn auf die Beine.
Als Theologin muss sich Saskia Wendel weiterhin in der Öffentlichkeit mit Gott sehen lassen; aber denken (oder sogar leben) tut es sich besser ohne ihn. Das sieht man daran, dass das Buch so gut wie ohne ein Zitat aus der Schrift auskommt. Freiheit wäre doch auch nach ihren eigenen Worten „Gabe“. Da müsste doch wenigstens ein Schriftzitat her. Statt dem Geber Ehre zu erweisen, wird die Gabe zum Götzen. Gott wird dagegen nur noch philosophisch thematisiert. Theologisch stört er nur, nämlich als Schöpfer und Offenbarer. Es ist ihr offenbar lieber, wenn dieser Gott mit der Menschheit Blinde Kuh spielt und sich der Mensch so, nur ausgestattet mit Freiheit und Vernunft, beim Suchen und Benennen Beulen holt (Wittgenstein) und in einen ausweglosen „blinden Golf steuert“ (Kant). Da befindet sich nämlich eine Theologie, deren Zentrum nicht mehr das ist, was sie im Namen trägt: Gott.
________________________
[1]Hans Jonas: Organismus und Freiheit: Ansätze zu einer philosophischen Biologie. Göttingen 1973.
[2] Robert Spaemann/Reinhard Löw: Natürliche Ziele. Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens. Stuttgart 2005.
von Dr. phil. Helmut Müller, Philosoph und Theologe, akademischer Direktor am Institut für Katholische Theologie der Universität Koblenz-Landau. Autor u.a. des Buches „Hineingenommen in die Liebe“, FE-Medien Verlag, Link: https://www.fe-medien.de/hineingenommen-in-die-liebe
Diesen Beitrag als Druckversion herunterladen unter diesem Link.