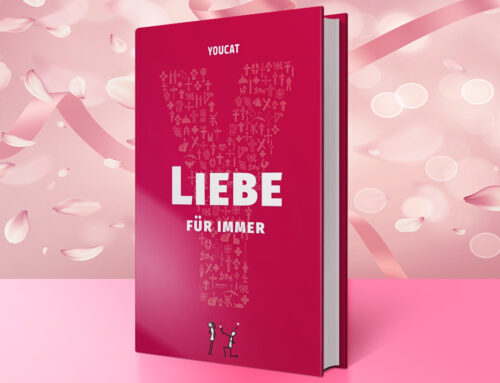Als Fastenserie posten wir jeden Freitag die Auslegung des Sonntagsevangeliums durch Dr. Martin Brüske.
Gottesfremde und Heimkehr:
Der verlorene Sohn.
Zum Evangelium vom vierten Fastensonntag C Lk 15, 1-3.11-32
„Vom verlorenen Sohn“, „von den zwei verlorenen Brüdern“, „vom barmherzigen Vater“ – neben der klassischen Bezeichnung hat man Alternativen gesucht, um dieses so reiche Gleichnis genau auf den Punkt zu bringen. Es bleibt wohl beim verlorenen Sohn, denn von ihm geht alles aus. Das ganze Drama von Gott und Mensch steckt in unserem Evangelium.
Ein sehr besonderer Text
„Das schönste Gleichnis Jesu“ und „Evangelium im Evangelium“ hat man es genannt. Es nimmt tatsächlich unter den Evangelientexten so etwas wie eine „Spitzenposition“ ein. Auch in Zeiten, in denen die Bibel ein weitgehend unbekanntes Buch geworden ist, haben noch relativ viele eine wenigstens vage Erinnerung daran. Es redet von einem unbedingt liebenden Gott. Es scheint deshalb – zumindest wenn man nicht allzu genau hinschaut – sehr gut mit einem Christentum kompatibel zu sein, das nicht aneckt durch unangenehme Forderungen und deshalb nicht quer steht zum Umfeld unserer Gegenwart. Ja, in der Tat: Dieses Gleichnis redet von einem Vater – wir werden es sehen – der aus grenzenloser Liebe „verrückte“ Dinge tut. Der seine Söhne in einer für ihn schmerzhaften Weise achtet. Und der um sie wirbt und ringt. Ja, im Gleichnis leuchtet so ein wirklich bedingungslos liebender Gott auf. Aber, aufgepasst, stromlinienförmig im Sinne eines anspruchslosen, harmlosen Evangeliums der billigen Gnade ist es deshalb noch lange nicht. Es geht hier auch um (symbolisch-realen) Gottes- und Vatermord, falsche Autonomie, die in Verknechtung endet, Entfremdung vom Leben bis zum geistlichen Tod durch Verhungern und nicht zuletzt um den Sinn der Tora, den Sinn der göttlichen Weisung, vor allem aber um die Beziehung, die diesen Sinn trägt und das gute Leben ermöglicht und um die Beziehungslosigkeit, die diesen Sinn zerstört. Wundervoll erzählt bringt Jesus wirklich sein Evangelium auf den Punkt: „Evangelium im Evangelium“ – einmalig verdichtet ist in diesem Evangelium das ganze Drama des „Gottesreichs“, das Jesus zur Mitte seiner Verkündigung gemacht hat, die kommende Königsherrschaft Gottes, in der in und durch Jesus Verlorene erwählt und errettet werden zu neuer Liebes- und Lebensgemeinschaft mit Gott. Am Ende sind Feste der Freude zu feiern. Aber harmlos ist das nicht: Denn unser Gleichnis redet über nichts anderes als Tod und Auferstehung des Sünders.
Der Ausgangspunkt: Nähe – Hörbereitschaft – Gemeinschaft (Lk 15, 1-3)
Sünder suchen Nähe. Sie haben sich in Bewegung gesetzt, um Jesus zu hören und darin seine Nähe zu erfahren. Er weist sie nicht zurück. Ja, er isst und trinkt mit ihnen: Urgestus der Gemeinschaft. Ihre Motive mögen nicht sehr klar sein: Eine diffuse Sehnsucht nach Veränderung, nach Heil und Heilung, nach Gott mag sich vermischen mit der Neugier, diesen Wunderrabbi, von dem alles spricht, einmal zu sehen. Der kleine Zachäus, auch ein Zöllner, einer, der die Leute ausnimmt, wird dafür sogar auf einen Baum klettern. Und vielleicht wirkt der Wunderrabbi ja ein Zeichen… Aber: Sie haben sich in Bewegung gesetzt. Sie wollen ihn hören. Und das, obwohl sie wissen oder ahnen, dass Jesus nicht so tun wird, als ob ihre Sünde harmlos oder gar nicht vorhanden wäre. Im Gegenteil: Der Rabbi redet davon, dass er gekommen ist, Verlorene zu retten. Verlorene! Sie ahnen weiter: Wenn stimmt, was er predigt, dass Gottes heilige Königsherrschaft ganz nah und im Kommen ist, ja dass sie anbricht in seinem Wort und in seiner Tat, dann rückt ihnen in Jesus der Heilige Israels aufs Fell. Der ihre Sünde aufdeckt, vor dem sie nicht bestehen können. Und trotzdem suchen sie seine Nähe, trotzdem haben sie sich in Bewegung gesetzt, trotzdem wollen sie ihn hören. Oder vielleicht gerade deshalb? Weil sie endlich wieder wahr werden wollen? Weil sie gemerkt haben, dass all die Lebenslügen, die subtilen und weniger subtilen Strategien der Selbstrechtfertigung nichts taugen, um glücklich zu sein? Weil sie sich ehrlich machen wollen in der Begegnung mit einem, der heilig ist und so die Wahrheit ihrer Verlorenheit aufdeckt und zugleich eine unbegreifliche Güte ausstrahlt, die nicht vernichtet, sondern neu macht – auch wenn es weh tut? Ja, wenn Gott so wäre, so heilig und so voll unbegreiflich gütiger Liebe – dann könnte man es wagen, neu anzufangen, sein Leben zu ändern. Dann könnte man es mit Gott wagen. Der Unbestechliche und Heilige, der mein Leben wahr macht, der wäre bei mir, an meiner Seite, um es auch neu zu machen. Und mit ihm zu leben! Das wäre Fülle, Freude, Glück! Wie gesagt: Das ahnen die, die kommen, mehr als sie es wissen – vielleicht sehr anfanghaft, wirr und ungeklärt. Aber die Sehnsucht treibt sie, das Ungenügen, der Hunger und der Durst ihrer in der Sünde ausgetrockneten und unterernährten Existenz. Und so haben sie sich in Bewegung gesetzt, suchen seine Nähe, wollen ihn hören. Und Jesus genügt das – und er isst und trinkt mit ihnen.
Den Hütern der Reinheit, Heiligkeit und Integrität Israels vor Gott passt das alles nicht. Wie kann Jesus Gemeinschaft mit Sündern aufnehmen, die noch nicht öffentlich, offensichtlich und greifbar Buße getan haben? Ja, der Sünder kann umkehren, er kann Buße tun und am Ende dieses Prozesses wieder in die Gemeinschaft des Gottesvolkes integriert werden. Wer aber noch gar nicht bekehrte Sünder wieder in die Gemeinschaft holt, der zerstört die Heiligkeit und Integrität des Gottesvolkes. Der nimmt die Sünde nicht ernst, übersieht ihr Gewicht – am Ende rechtfertigt er sie. Und das empört sie und macht sie zornig. Wäre es so: Sie lägen nicht falsch. Aber sie übersehen das Gottesgeschehen, das in Jesus nach den Menschen greift und sie übersehen das Herzensgeschehen, das Sünder in Bewegung setzt, um das Wort Jesu zu hören. Und deshalb erzählt ihnen Jesus drei Gleichnisse. Und wirbt so auch um sie, um ihre Mitfreude über Gottes Güte. Die ersten beiden Gleichnisse akzentuieren das Gottesgeschehen. Das dritte Gleichnis lässt Gottes- und Herzensgeschehen aufleuchten. Es ist das vom verlorenen Sohn, vom verbitterten Bruder und vom barmherzigen Vater, der beide göttlich-närrisch und göttlich-weise liebt.
Symbolischer Vatermord
Zwei Söhne eines Vaters. Großbauernfamilie: Hier gibt es Knechte und Tagelöhner und eben die zwei Söhne, die zukünftigen Erben nach den Regeln des jüdischen Erbrechts. Der ältere Sohn wird den Hof erben, dem jüngeren werden Anteile des beweglichen Vermögens zustehen. Der Vater bestimmt die Ordnung des Hauses, am Ende, in der bitteren Zornrede des älteren Sohnes, ist ausdrücklich von seinen Geboten die Rede. Wir werden allerdings auch sehen: Dieser Vater verhält sich gleichzeitig gegenüber seinen Söhnen so gar nicht rigide und autoritär. Beides scheint wirklich zu sein: eine Ordnung des väterlichen Hauses, die die Form des Gebots hat und ein gänzlich unautoritärer Führungsstil, der die Freiheit will und achtet. Selbst wenn diese Achtung Schmerz und Sorge für den Vater bedeutet. Denn diese Freiheit ist weder harmlos noch neutral. Leben und Tod hängen von ihr ab. Jedenfalls: Der Vater in unserem Gleichnis ist alles andere als ein patriarchaler Autokrat.
Der jüngere Bruder erbittet ziemlich direkt Erbteilung vor dem Tod des Vaters. Wir fragen: Wozu? Aber das wird nicht gesagt, erst sein Verhalten macht deutlich, worum es ihm ging. Bewertet wird weder das Verlangen des jüngeren Bruders, noch der ganze Vorgang der Erbteilung. Auch hier wird erst an den Folgen deutlich, dass ein Abstieg ins Elend beginnt. Lakonisch wird lediglich festgestellt, dass der Vater – ohne große Diskussion und ohne Einsatz der väterlichen Autorität – das Erbe aufteilt. So, ohne äußerlich nachvollziehbare Motivation, wird es den Vater tatsächlich arg geschmerzt haben, erst recht, wenn er ahnt, worauf die Geschichte hinauslaufen wird. Aber er respektiert und achtet in auffälliger Weise das Verlangen des Sohnes: Gebot und Freiheit scheinen sich in seinem Haus nicht auszuschließen. Nun: Eine solche vorzeitige Erbteilung ist nicht unmöglich, üblich war sie sicher nicht. Aber eines ist klar: Nießbrauch und Erträge bleiben bis zum Tod des Erblassers bei ihm, auch wenn der Besitz übertragen wurde.
So ist aber das, was jetzt geschieht, nichts anderes als symbolischer Vatermord: Nach einer Schamfrist von wenigen Tagen hat der jüngere Sohn sein Erbteil zu Geld gemacht und geht damit auf und davon. Er handelt also, als ob der Vater gestorben wäre. Sein Handeln kommuniziert dem Vater ja dann auch: Du bist für mich gestorben. Ja, durch sein Handeln führt er diese Situation erst herbei: Er hat den Vater symbolisch getötet.
Fremde und Elend
Und damit hat er auch die Ordnung des väterlichen Hauses, seines Gebots, hinter sich gelassen. Er zieht in die Ferne und Fremde. In die jüdische Diaspora. Dorthin, wo weder das väterliche Gebot noch die Tora Gottes den Alltag bestimmt. Das wird im Text klar angedeutet: Bald wird er sich bei einem Schweinezüchter verdingen müssen. Das Schwein aber ist im Sinn der Tora der Inbegriff der Unreinheit. Wo Schweine gezüchtet werden, da kann die Tora nicht gelten.
Erst jetzt erfolgt im Mund Jesu, des Gleichniserzählers, eine Wertung: Die Lebensführung des jüngeren Bruders ist „zügellos“. Das heißt nichts anderes: Sie hat sich von Normen, von den Geboten, „befreit“. Der Sohn will emanzipiert leben, autonom und selbstbestimmt. Der symbolische Vatermord war ein Akt der Selbstbefreiung aus den vermeintlich beschränkenden und knechtenden Ordnungen und Geboten des väterlichen Hauses. Aber diese „Emanzipation“, die durchaus pubertäre Züge aufweist, führt zur „Verschleuderung“ der Lebensgrundlagen: Das ererbte Vermögen wird in kürzester Zeit aufgebraucht. Hier wird mit einer geradezu unheimlichen erzählerischen Ökonomie auf den Punkt gebracht: Das emanzipiert-autonome Leben des jüngeren Bruders war ein Leben aus dem Impuls des Augenblicks, aus dem unmittelbaren sinnlichen Reiz und seiner Lust. Nicht einmal die Notwendigkeiten der Selbsterhaltung hatten sein Handeln bestimmt: Im Augenblick, als die äußere Lage prekär wird, als eine Hungersnot eintritt (in der Antike kein seltenes Phänomen), sind alle Ressourcen aufgebraucht: Der junge Mann ist blank. Die Folge ist Elend.
Nun aber: Eine Rückkehr ins väterliche Haus kommt für ihn erst einmal auf keinen Fall infrage. Wie sollte er „so“ vor dem Vater erscheinen? Nein, zu Kreuze kriechen: Das geht gar nicht! Dazu ist er – noch jedenfalls – zu stolz…. Und – jetzt wird es ein weiteres Mal deutlich – gerade deshalb kann er auch keine Hilfe von der jüdischen Gemeinde in Anspruch nehmen. Denn die repräsentiert für ihn viel zu sehr das väterliche Haus. Man muss dazu wissen: Die jüdische Diaspora kannte ein hochentwickeltes System der sozialen Unterstützung für in Not geratene Jüdinnen und Juden: In Not geraten solltest du dir die Füße wund laufen, um die nächste jüdische Gemeinde zu finden. Aber das will der jüngere Sohn um keinen Preis.
So bleibt ihm nur, etwas zu tun, was gleich in mehrfacher Weise entwürdigend ist. Von seinem Stolz gebunden, der ihn hindert, die Hilfe der jüdischen Gemeinde in Anspruch zu nehmen oder ins väterliche Haus zurückzukehren, muss er sich bei einem Heiden zum Schweinehüten verdingen – und er muss sich aufdrängen, um den Job überhaupt zu bekommen. Sich aufdrängen, um Knecht zu sein, bei einem Heiden, um Schweine zu hüten – und trotzdem weiter zu hungern, denn offensichtlich reicht es kaum zum Leben: Freiheit, Emanzipation und Autonomie hat sich unser Sohn wohl anders vorgestellt. Der Großbauernsohn ist unter entwürdigenden Bedingungen am anderen Ende der sozialen Leiter angekommen. Er hat nicht nur – so empfindet er es selbst – sein Vermögen, sondern seine Sohnschaft verspielt. Er, der am Anfang seinen Vater symbolisch mordete, ist jetzt als Sohn und Jude geistlich tot, als Tagelöhner, der darum betteln muss, bei den Heiden die Schweine zu hüten. Übrigens, das Schweinefutter, das er in seinem ungestillten Hunger so gerne gegessen hätte und das ihm niemand gibt, wenn er mit den Schweinen heimkommt und andere die Tiere versorgen, die Schoten des Johannisbrotbaums, nähren, anders als das Fruchtfleisch, nicht. Sie füllen nur den Magen. Der Weg des Sohns hat ins äußerste Elend geführt….
Besinnung und Heimkehr
„Wenn der Jude Johannisbrot essen muß, dann tut er Buße.“ So heißt es bei den Rabbinen. Von unserem jüngeren Sohn aber heißt es: Da ging er in sich, da besann er sich. Aber wir finden da – Jesus ist äußerst realistisch – zunächst gar keine tiefe Reue, etwa darüber, wie tief sein Handeln den Vater verletzt haben muss oder ähnlich. Sondern äußerst pragmatisch: Selbst die Tagelöhner meines Vaters sind im Überfluss mit Nahrung versorgt, die Tagelöhner mit ihrer prekären Situation, mit der täglichen Frage, ob wieder Arbeit für sie da ist, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich dagegen: Ich drohe zu verhungern. So klar, so einfach, so eindeutig. Aber das heißt auch: Ich bin mit meinem Emanzipationsprogramm gescheitert. Und: Ich muss anerkennen. Ich habe falsch und unreif gedacht. Am Ende war die Grundlage meines Lebens verbraucht. Denn jetzt ist mir klar geworden: Die Ordnung des väterlichen Hauses ist lebensfreundlich. Sie sichert das gute Leben. Selbst die Tagelöhner sind versorgt. Von der Sohnschaft wagt er schon nicht mehr zu träumen. Denn die Sohnschaft meint er endgültig verspielt zu haben. Als Sohn ist er tot. Und an Auferstehung wagt er noch nicht zu glauben. An Freiheit endlich will er gar nicht mehr denken.
Und deshalb legt er sich ein „Sprüchlein“ zurecht: Vater, gegen den Himmel und dich habe ich gesündigt. Die Sohnschaft habe ich verspielt. Ich habe es begriffen. Lass mich Tagelöhner sein. Dann macht er sich auf.
Jetzt aber geschieht das völlig Unerwartete, das uns den Charakter des Vaters offenbart. Als er seinen Sohn am Horizont auftauchen sieht, am äußersten Punkt, an dem das möglich ist, stürmt er los. Das ist nach orientalischer Sitte für eine Respektsperson, zumal für einen älteren Mann, würdelos. Das tut man nicht. Aber die Liebe tut solche Dinge. Der Vater liebt seinen Sohn, der da in der Ferne auftaucht, närrisch. Offensichtlich ist dieser Vater innerlich immer bei seinem Sohn gewesen. Seine Achtung für die Entscheidung des Sohnes war das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Dem Sohn in der Ferne, in der Entfremdung vom Haus des Vaters, war dieser Vater in jedem Augenblick innerlich nah. Und weil in diesem Vater der lebendige Gott aufleuchtet, dürfen wir sagen. Er war ihm auch real nah – und hat um ihn geworben und gerungen.
Als der Vater bei ihm ankommt, noch bevor der Sohn überhaupt reagieren kann, fällt er ihm um den Hals und küsst ihn. Damit definiert er die Situation: Er nimmt ihn an, noch bevor ein Wort gewechselt ist und nimmt ihn damit wieder auf in die Gemeinschaft mit sich. Der Sohn setzt jetzt an, sein Sprüchlein zu sagen, das eigentlich durch das wortlose, ganz unmittelbare Handeln des Vaters schon überholt ist. Er lässt ihn nicht aussprechen. Er gibt sofort Anweisung, ihn in den vollen Status als Sohn wieder einzusetzen: das standesgemäße Kleid, die Sandalen, die den Sohn von den nackten Füßen des Tagelöhners unterscheiden und der Siegelring, der ihm Anteil an der väterlichen Autorität gibt. Dieser Sohn wird in der lebensfreundlichen Ordnung des väterlichen Hauses frei sein. Wahrhaft frei!
Am Ende steht das Fest der Freude und die Offenbarung der Bedeutung des ganzen Geschehens durch den Vater: „Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden.“
Und der ältere Bruder? Ein offener Schluss
Erinnern wir uns: Jesus wollte in drei Gleichnissen seinen Kritikern antworten, mehr noch: um sie werben und zur Einstimmung in die Freude einladen. Das verdichtet sich im Gleichnis in der Gestalt des älteren Sohnes. Er kommt vom Feld, arbeitsam, fleißig, gehorsam dem Gebot des Vaters – und ihm innerlich vollkommen entfremdet. Der, der räumlich die ganze Zeit nah war, ist dem Vater so fremd und fern wie sein jüngerer Bruder. Er akzeptiert das Joch des väterlichen Gebots, aber er realisiert nicht die Gemeinschaft mit dem Vater. So verbittert er innerlich, meint, ihm werden vom Vater Leben und Freude vorenthalten. In ihm sammelt sich Gift an. Als er erfährt, wieso im väterlichen Haus offensichtlich gefeiert wird, protestiert er heftig, voller Bitternis und Zorn und weigert sich, das Haus des Vaters zu betreten. Leiblich ganz nah ist er himmelweit weg. Aber auch zu ihm kommt der Vater, er kommt wieder aus dem Haus heraus und bewegt sich auf den Sohn zu. Begütigend redet er zu ihm. Denn er liebt beide Söhne. Er will sie in der lebensfreundlichen Ordnung im Haus des Vaters. Er will sie in der Gemeinschaft der Freude mit sich. Er lädt ihn ein zur Mitfreude. So ist auch der ältere Sohn, der brav ist und doch voll Bitterkeit, dem Vater fremd. Auch er ist ein verlorener Sohn, der lediglich, anders als sein Bruder, den äußeren Aufstand nicht gewagt hat. Aber voller Liebe wartet der Vater auch auf ihn, wirbt und ringt um ihn. Und so ringt er um jeden von uns, bis er sagen kann:
„Denn dieser, mein Sohn, diese meine Tochter war tot und lebt wieder; er oder sie war verloren und ist wiedergefunden worden.“
Dr. theol. Martin Brüske
Martin Brüske, Dr. theol., geb. 1964 im Rheinland, Studium der Theologie und Philosophie in Bonn, Jerusalem und München. Lange Lehrtätigkeit in Dogmatik und theologischer Propädeutik in Freiburg / Schweiz. Unterrichtet jetzt Ethik am TDS Aarau. Martin Brüske ist Mitherausgeber des Buches “Urworte des Evangeliums”.
Weitere Beiträge aus der Serie Fridays for FAITH:
Evangelium des ersten Fastensonntags