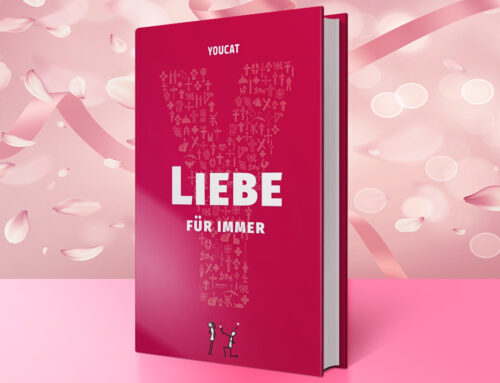Die Serie der Auslegung des Sonntagsevangeliums durch Dr. Martin Brüske geht weiter.
Frühstück am Ufer der Ewigkeit.
Auslegung des Evangeliums vom 3. Sonntag der Osterzeit C Joh 21, 1-19
„Mein Herr und mein Gott!“ war das letzte Jüngerwort am letzten Sonntag. Ein Zielpunkt im Johannesevangelium. Das nächste Wort: „Ich gehe fischen.“ Was für ein Kontrast! Aber vom Boden des Alltags aus tun sich plötzlich die letzten Dinge auf: Der Verleugner wird der Hirte. Das Maß seines Dienstes ist die Liebe. Er wird sie im Martyrium vollenden.
Jünger im Wartestand: Ein Epilog zum Evangelium des Johannes
Das Evangelium des letzten Sonntags hatte seinen Ort in Jerusalem. Und wenn man seine abschließenden Verse liest und zuvor das Bekenntnis des Thomas und die Worte Jesu über die, die selig sind, wenn sie glauben, auch wenn sie nicht sehen (also wir!) und wüsste nicht, dass noch etwas folgt: Natürlich würde man davon ausgehen, dass hier wuchtig und schön der Schluss des Evangeliums gestaltet wurde!
Tatsächlich folgt hier aber ein Epilog von einer wundersamen Gestimmtheit und Atmosphäre, die mich in ihren verschiedenen Schichten immer wieder tief berührt: ein früher Morgen nach einer Nacht voll vergeblicher Mühe, der sich zum Morgen der Ewigkeit wandelt. Diese Perikope lässt mich immer wieder staunen. Persönlich bin ich überzeugt, dass dieser Epilog von keiner anderen Hand als der des Evangelisten stammen kann und dass dieser Evangelist niemand anders ist als der Zebedaide Johannes. Er ist von ihm entweder ganz früh seinem schon fertigen Evangelium hinzugefügt worden oder von vornherein als wundersamer Epilog von ganz eigener Art für die Gesamtkomposition des Evangeliums vorgesehen gewesen. Und zwar dann auf Grund seiner ganz eigenen Prägung bewusst als Epilog erzählt und gleichzeitig für das Evangelium notwendig. Leider bricht das Sonntagsevangelium mit der Ansage des Martyriums Petri ab und lässt den Ausblick auf den Lieblingsjünger Johannes (nebst den Schlussversen) weg. Tatsächlich wird nämlich erst in diesem Epilog das Verhältnis des charismatisch erkennenden Lieblingsjüngers zu Petrus zur Klarheit gebracht – ein Thema, das im „Haupttext“ des Evangeliums offen geblieben war. Und das ist ein wesentliches Thema dieses vor Atmosphäre geradezu vibrierenden Abschnitts. Aber sehen wir zu!
Wie schon angedeutet: Die Begegnung Maria Magdalenas mit dem Auferstandenen und die zweimalige Erscheinung vor den Jüngern hatte in Jerusalem stattgefunden. Jetzt hat der Schauplatz gewechselt. Wir sind am See (wörtlich im Text: Meer!) von Tiberias. Und das erste Wort, das wir hören aus dem Mund des Petrus – und er hat eben auch hier das erste Wort – ist ein Wort radikaler Alltäglichkeit: „Ich gehe fischen.“ Offensichtlich hat die Feststellung Aufforderungscharakter: Sechs weitere Jünger schließen sich an. Von der höchsten Höhe des Thomasbekenntnisses in Jerusalem sind wir auf dem Boden des galiläischen Fischeralltags angekommen. Von österlicher Euphorisierung keine Spur mehr. Das bedeutet nun nicht gerade Desinteresse an dem, was ihnen widerfahren war, oder auch, dass hier eigentlich eine alternative Erstbegegnung mit dem Auferstandenen erzählt wird (beides ist vermutet worden), sondern zunächst schlicht eine große und irgendwann notwendig eintretende Veralltäglichung. Man musste ja sein Leben führen und seinen Lebensunterhalt verdienen. In Galiläa gab es sicher Dinge zu ordnen. So führt sie der Weg in ihre alte Heimat zurück und zu ihrem Berufsalltag. Denn mindestens drei der Genannten – Petrus und die Zebedaiden – sind uns als Berufsfischer bekannt. In einer gewissen Weise zeigt diese galiläische Episode einen Wartestand an, eine Schwebe: Jünger, deren neue Rolle noch nicht endgültig definiert ist und die sich im Übergang zu dieser neuen Rolle befinden. Ein Zustand, der erst Pfingsten – und dann wieder in Jerusalem – sein Ende findet.
Eine Nacht voll vergeblicher Mühe
Typisch für Johannes ist, wenn man so will, seine „Tiefenschau“: seine Fähigkeit in vordergründig gewöhnlichen Konstellationen tiefere Dimensionen zu sehen, ja mit einer solchen mehrfachen, tiefgeschichteten Bedeutsamkeit aus Vorder- und Hintergrund, aufblitzender Tiefe und vordergründigem Missverständnis etwa, ganz bewusst erzählerisch zu gestalten. Der inspirierende Geist schafft dem Evangelium auch einen wunderbaren literarischen Leib! Man darf die einzelnen Elemente dabei nicht isoliert betrachten, sondern muss, vor- und zurücklesend, ihr Zusammenspiel wahrnehmen. In der Alltäglichkeit des Handwerks galiläischer Fischer bereitet sich ein Blick in die letzten Dinge und in die Dimension der Ewigkeit vor.
Hier also erst einmal zwei kleine Details, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, im Auge behalten sollten – für sich allein noch nicht sprechend, sehr wohl aber im Spiel des Ganzen: Es sind zum einen sieben Jünger, die hier zusammen fischen. Das könnte eine symbolische Zahl sein, die Fülle und Ganzheit andeutet. Und der See von Tiberias wird mit einem Wort benannt, das eigentlich „Meer“ bedeutet. Das ist nicht unmöglich, aber es stände eine Alternative zur Verfügung. „Meer“ und „Ufer“ – auch das könnte eine Konstellation sein, die auf eine tiefere Dimension hinweist.
Auch im See von Tiberias wird in der Nacht gefischt. Es ist ein Boot, das in die Nacht hinausfährt. Auch das ist wiederum ebenso gewöhnlich, wie es im Zusammenhang noch wichtig werden wird: ein Boot mit sieben Jünger-Fischern auf einem See, der „Meer“ genannt wird. Es ist wiederum nicht ungewöhnlich, dass die Nächte an diesem See heiß und schwül bleiben und kaum abkühlen. Der hier schreibt, hat es nicht nur einmal erlebt. Wer also körperlich arbeitet, wird sich seiner Kleidung weitgehend entledigen. In antiken Darstellungen von Fischern ist Nacktheit und weitgehende Nacktheit nicht ungewöhnlich und deshalb ist es auch die Nacktheit des Petrus nicht. Und wiederum: Auch dieses Detail sollte man im Auge behalten. Jedenfalls: Erfolg beim Fischfang ist kein Automatismus, auch für Berufsfischer nicht. In dieser Nacht bleibt der Erfolg aus. Im Morgengrauen wird klar: Die ganze schweißtreibende Mühe war umsonst. Es ist der Augenblick da, wo man das Unternehmen aufgeben muss und frustriert, müde und hungrig den Rückweg antritt.
Eine geheimnisvolle Gestalt
Da steht plötzlich einer, wie aus dem Nichts, am Ufer. Man kann auch sagen: Er trat an den Strand, wie Jesus im vorherigen Kapitel in die Mitte seiner Jünger trat. Es ist das gleiche Wort. Der auferstandene Jesus „erscheint“ den Jüngern zum dritten Mal. Ganz ausdrücklich halten das die Rahmenverse dieser Erscheinung fest. Das hat – finde ich – eine ungeheure imaginative Kraft. Das Auftreten der Gestalt im Morgenlicht, dieses zunächst einfache Dasein, das Stehen am Ufer, am Strand, der gegenüber den Jüngern auf dem See ganz unmittelbar „die andere Seite“ repräsentiert, von der her sich Jesus zu sehen gibt, berührt mich immer wieder neu und tief. Anders als Leserinnen und Leser, denen es mitgeteilt wird, dass es Jesus ist, vermögen die Jünger aber die geheimnisvolle Gestalt im Grauen des Morgens nicht zu identifizieren. Steht sie noch im Halbdunkel oder wird sie vielleicht von den flachen Strahlen der aufgehenden Sonne so beleuchtet, dass im Glanz nur ihr Umriss zu erkennen ist?
Und nun redet die geheimnisvolle Gestalt. Sie redet die Jünger an mit einem Wort intimer Vertrautheit: Paidia, Kinder, habt ihr Zukost für mich? Zukost (prosphagion), das ist die Ergänzung des Grundnahrungsmittels Brot – für das Frühstück, gewöhnlich eben Fisch. Fischer, die von ihrer nächtlichen Arbeit heimkommen, nach Fisch als Zukost zum Frühstück zu fragen, ist nicht ungewöhnlich. Aber die erfolglosen Fischer können die Frage nur mit einem ebenso knappen wie wohl auch frustrierten „Nein“ beantworten. Aber bei der Anrede „Kinder“ werden die Jünger aufgehorcht haben: Wer ist das? Und in einem – dem Lieblingsjünger Johannes, ausgestattet mit dem kontemplativen Blick in die Tiefe – wird es spätestens jetzt mächtig arbeiten: Was geht hier vor? Wer ist das? Sollte es vielleicht…?
Der reiche Fischfang
Nun bekommt unser Evangelium eine entscheidende Wendung. Das knappe, frustrierte „Nein“ der Jünger im Boot beantwortet die Gestalt am Ufer mit der Aufforderung, das Netz an der guten und glücksverheißenden rechten Seite auszuwerfen. „Und ihr werdet finden.“ Hier wird die geheimnisvolle Autorität der Gestalt am Ufer ganz deutlich: Widerspruchslos gehorchen sie. Das ist ja unmittelbar gar nicht einsichtig. Nach der frustrierenden Erfolglosigkeit der Nacht erfahrenen Berufsfischern einfach mal so zu sagen, versucht es doch mal auf der rechten Seite, dann werdet ihr finden, ist – gelinde gesagt – befremdlich. Etwas geht aber von ihm aus, das als Antwort nur möglich macht, seiner Weisung zu folgen. Der Gehorsam führt zu einem übervollen Netz, so voll, dass sie im Boot nicht stark genug sind, das Netz einzuholen – auch das sollte man sich merken im Blick darauf, wie das Netz schließlich an Land kommt.
„Ohne mich könnt ihr nichts tun.“
Vom reichen Fischfang auf die Weisung des Auferstandenen hin, gibt die Alltäglichkeit des ersten Teils nun plötzlich ihre Tiefendimension frei. Ohne jede Künstlichkeit erscheint hier der Weg der Kirche. „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ – das sagt Jesus in unserem Evangelium. Den Weg auf eigene Faust zu gehen, führt in die Frustration. Gesegnete, glückende Aktivität gibt es nur im Hören auf das Wort des Auferstandenen. Auf sein Wort hin schenkt der Herr überreiches Gelingen. Die sieben Jünger in dem einen Boot Petri: Das ist also tatsächlich ein Bild der Kirche. Und ohne jede Gewaltsamkeit verwandelt sich die alltägliche Szene auf dem See, an dessen Ufer, also von der anderen Seite her, der Auferstandene erscheint, zum Gleichnis von Zeit und Ewigkeit. Die alten Exegeten von Augustin bis Rupert von Deutz und darüber hinaus haben den Sachverhalt grundsätzlich sehr genau erfasst.
Petrus
Der aber, der in der Aufforderung zum (erfolglosen) Fischfang das erste Wort hatte, soll und muss noch in einen ganz anderen Primat eingeführt werden. Das kann nur so geschehen, dass seine Liebe neu geweckt wird und die Schuld seiner Verleugnung von der Tiefe her angegangen wird. Bereut und weint Petrus in den drei ersten Evangelien unmittelbar nach der Verleugnung, ist bei Johannes hier eine offene Stelle. Der Hahn kräht. Eine Reaktion des Petrus wird nicht berichtet. Es wäre überzogen, daraus zu folgern, dass Petrus bei Johannes erst in unserem Evangelium bereut. Aber unser Evangelium zeigt, dass die Last der Verleugnung noch auf der Seele des Petrus liegt. Sie zeigt aber auch, dass der Schmerz der Verleugnung bei Petrus zu einer größeren Liebe führt, die sich im Erkennen des Auferstandenen Ausdruck verschafft.
Und wieder wird ihm der charismatisch und kontemplativ sehende Zeuge Johannes unverzichtbare Hilfestellung bieten. Er hatte ihn in den Hof des Hohepriesters geführt (was allerdings zur Katastrophe der Verleugnung führte), er war mit ihm zum Grab gelaufen und hatte die Zeichen richtig gelesen. Jetzt erkennt er im Zeichen des überreichen Fischfangs den auferstandenen Jesus. Sein Herz hatte wohl schon seit dem Erscheinen der geheimnisvollen Gestalt gebrannt, zunehmend hatte es sich in ihm verdichtet – jetzt ist er wieder der erste Jünger, der begreift, erkennt und sieht: „Es ist der Herr!“
In aktivem Handeln aus leidenschaftlicher Liebe aber antwortet Petrus spontan auf diese Nachricht. Er will, er muss sofort zu seinem Herrn. Er findet sich nackt – und umgürtet sich rasch mit dem Obergewand. Auch hier ist die Alltäglichkeit im Sinnzusammenhang des Evangeliums hintergründig durchscheinend. „Nackt“ ist der Verleugner Petrus, wie sich Adam und Eva nackt fanden, aber das Kleid der Liebe deckt diese Nacktheit zu. So springt er in den See, um so schnell wie möglich zu seinem Herrn zu kommen. Denn im Boot ist man ja noch mit dem überreichen Fang der 153 großen Fische (153 ist die Dreieckszahl der Primzahl 17: 1+2+3….+ 17 – Symbol für die Vollzahl aller Auserwählten; m.E. ist diese Deutung sehr plausibel) beschäftigt, den man kaum bewältigt.
In diesem Zusammenhang wird der Symbolismus auf die Rolle des Petrus in der Kirche – ich schreibe diese Zeilen ja im Blick auf ein kurz bevorstehendes Konklave – überdeutlich. Petrus wird das überschwere Netz, mit dem kaum umzugehen ist, schließlich an Land ziehen – was praktisch unmöglich ist. Und dieses Netz wird nicht zerreißen. Seine neu erwachte Liebe gibt ihm die charismatische Kraft für seinen Dienst, die Einheit zu wahren. Nach genau dieser Liebe wird Jesus ihn fragen, um ihn in seine primatiale Rolle einzusetzen, die ganze Herde zu weiden. Aber gerade in dieser Einsetzung auf Grund seiner Liebe muss er auch noch einmal durch die Bitterkeit seiner Verleugnung gehen.
Das beginnt, als er das Ufer betritt: Ein Kohlenfeuer brennt, darauf (ein) Fisch und Brot. Dieses Kohlenfeuer hat es in sich. Es löst sofort eine bittere Assoziation in ihm aus. Ein solches Kohlenfeuer brannte auch im Hof des Hohenpriesters in der Nacht der Gefangennahme. Es ist tatsächlich das gleiche griechische Wort!
Nach dem Mahl fragt Jesus ihn dann nach seiner Liebe. Das Verhalten Petri hat seine leidenschaftliche Liebe zu Jesus gezeigt, der Sprung in den See, das Einholen des Netzes. Er hatte spontaner und intensiver reagiert als alle anderen, selbst als der kontemplative Charismatiker Johannes. So fragt Jesus ihn zuerst: Liebst Du mich mehr als diese?
Der „alte“ Petrus hatte gemeint, viel von sich zu wissen, er hatte gemeint, bereit zu sein, für Jesus in den Tod zu gehen. Der „neue“ Petrus weiß nichts mehr von sich, alle Selbstgewissheit ist ihm zerfallen. So verweist er, der Liebende, dreimal die Frage Jesu in Jesu barmherziges Wissen um Petrus zurück. In Jesu barmherzigenm Wissen ist die Liebe Petri aufbewahrt und geborgen. Als er zum dritten Mal gefragt wird und mit dieser Frage noch einmal durch den Schmerz der Verleugnung muss, birgt er sich sogar in der Allwissenheit Jesu: „Du weißt alles“. „Gott ist größer als unser Herz“ heißt es im ersten Brief des Johannes.
Aber gerade dieser Petrus, der liebt, aber dem alle Selbstgewissheit zerfallen ist, der nichts mehr von sich weiß, kann in seinen Dienst an der ganzen Herde und ihrer Einheit eingesetzt werden. Die größere Liebe ist das Kriterium dieses Dienstes. Am Ende wird sich diese Liebe im Martyrium des Petrus erfüllen, wie der Schluss des Evangeliums diskret, aber deutlich ankündigt.
Frühstück am Ufer der Ewigkeit
Und wieder die Alltäglichkeit, die mit der Tiefenschicht gerade in der Mahlszene untrennbar verbunden ist. Beides ist ineinandergespiegelt: Menschlich anrührend und zugleich beladen mit dem Gewicht ewiger Herrlichkeit. Es ist zunächst unglaublich menschlich: Der auferstandene Jesus bereitet seinen Jüngern das Frühstück. Aber indem die Jünger das Ufer betreten, betreten sie sozusagen die Seite, von der Jesus sich ihnen offenbart hat: In diesem Frühstück am „Meer“ von Tiberias ist der Vorgeschmack von Ewigkeit und Vollendung zu spüren. Eine Vorwegnahme des himmlischen Festmahls. So ist die Symbolik nicht unmittelbar, sondern – wenn man so will – „vermittelt“ eucharistisch. Dieses Frühstück bildet nicht die Eucharistie ab, sondern in jeder Eucharistie findet sich der Vorgeschmack des Himmels, der auch in diesem Frühstück am See präsent wird. Auf dem Feuer findet sich genau ein Fisch. Augustin liegt wohl genau richtig, wenn er in diesem Fisch den Christus der Passion sieht: „Piscis assus, Christus est passus“, der gebratene Fisch ist der leidende Christus. Die Jünger sollen von den gefangenen Fischen hinzugeben. Sie sollen in das Leidens- und Ostergeheimnis aufgenommen werden. Wir alle müssen das. Wie Petrus. Dann aber kann uns der auferstandene Herr einladen zum Frühmahl der Liebe.
Dr. theol. Martin Brüske
Martin Brüske, Dr. theol., geb. 1964 im Rheinland, Studium der Theologie und Philosophie in Bonn, Jerusalem und München. Lange Lehrtätigkeit in Dogmatik und theologischer Propädeutik in Freiburg / Schweiz. Unterrichtet jetzt Ethik am TDS Aarau. Martin Brüske ist Mitherausgeber des Buches “Urworte des Evangeliums”.
Weitere Beiträge aus der Serie Fridays for FAITH:
Evangelium des ersten Fastensonntags
Evangelium des zweiten Fastensonntags
Evangelium des dritten Fastensonntags
Evangelium des vierten Fastensonntags