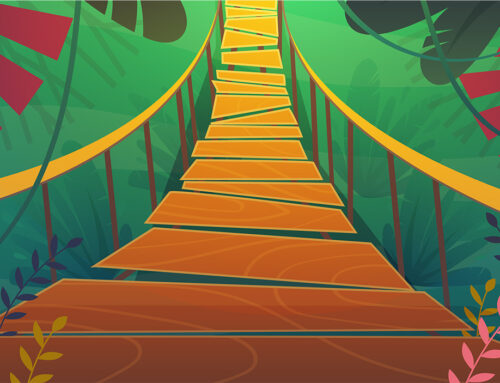Warum die „neue Sexualmoral“ auf dem Synodalen Weg unmoralisch ist
Ende Oktober 2022 kam es in Bonn Bad Godesberg zu einer denkwürdigen Begegnung. Birgit Mock (Vizepräsidentin Synodaler Weg und ZdK) und Bernhard Meuser (Mitinitiator „Neuer Anfang“) trafen zur Debatte über die Themen des Forum IV („Leben in gelingenden Beziehungen“) aufeinander. Während Birgit Mock ihre Standardrede vortrug, nutzte Bernhard Meuser das erste direkte Aufeinandertreffen zu einer Generalabrechnung mit den radikalen Vorstellungen der Synodalen. Interessant ist, dass die Kardinäle Ouellet und Ladaria in ihren jetzt bekannt gewordenen Einschätzungen zum Synodalen Weg, die sie beim ad-limina-Besuch der deutschen Bischöfe in Rom vortrugen, exakt mit der Einschätzung Bernhard Meusers übereinstimmen. Hier die Langversion seines in freier Rede gehaltenen Vortrages.
Sehr geehrte Frau Mock, liebe Zuhörer,
gerne würde ich Ihnen etwas Positives zu den Texten sagen, die Sie in Forum IV des Synodalen Weges mitverantwortet haben. Es fällt mir schwer. Der Synodale Weg ist mit dem Anspruch aufgetreten, eine „neue Sexualmoral“ zu begründen. Ich finde, das ist ihm nicht gelungen. Ich werde das auf mehreren Ebenen begründen: einer moralischen, einer anthropologischen, einer empirischen und einer theologischen.
An der Realität verlorener Beziehungen vorbei
Doch zuvor ein Haupteinwand gegen die „neue Sexualmoral“: Sie hat keinen „Impact“ für die Leute in meinem Viertel. Es wird der Frau nichts sagen, deren Mann im Außendienst in Singapur eine Beziehung begann; jetzt führt er 50 km entfernt eine Zweit-Ehe. Es wird dem unverheirateten Pärchen nichts sagen, das sich gerade mit Elterngeld luxuriös eingerichtet hat. Auch der vom Liebhaber verlassenen, kinderlosen Frau wird es nichts sagen; sie kümmert sich jetzt um Hunde, mit denen sie an den oft verwaisten Spielplätzen vorbeiflaniert. Die neue Sexualmoral wird auch „Anne“ nichts sagen; sie kam gerade aus dem Balkan heim: drei Kindern, keine Ausbildung. Mit 16 hatte sie sich mit einem Mann eingelassen, ihn sogar noch geheiratet, die Kinder nicht abgetrieben. Alles zerbrach in der Fremde. Auch ihr Bruder wird sich nicht für Ihre Konzepte interessieren. Es gibt ihn nicht mehr. Das heißt: Es gibt ihn schon noch im Dachgeschoss des Einfamilienhauses, – ihn und seinen Laptop. Niemand weiß, ob es Spielsucht ist oder Pornographie oder beides. In meinem gutsituierten Viertel leben, heißt leben in einer Welt der traurigen oder verlorenen Beziehungen.
Alle diese Menschen sind oder waren katholisch. Von der Kirche lesen sie nur Meldungen über Missbrauch und neuerdings, dass dort diverse Personen terrorisiert werden. Dass ihnen die Kirche nichts mehr sagt, hat aber gewiss andere Gründe, als eine veraltete Sexualmoral. Dazu hätte diese Moral in irgendeiner Weise ihr Leben bestimmen müssen. Sie war aber nie ein Faktor; die Leute lebten so, wie alle Leute leben. Kein Kirchenmensch sprach zu ihnen von Liebe, Ehe, Sexualität. Ich selbst bin Jahrgang 1953. Die letzte Katechese, an die ich mich erinnere, fand 1965 statt, als uns ein weißhaariger Priester belehrte, wir sollten uns besser nicht nackt anschauen und nachts die Hände über der Bettdecke halten.
1. Moralisch gesehen …
Den Leuten in meinem Stadtteil fehlt jede Basis für eine neue Moral-Theologie. „Moral“ haben sie selber – und zur Theologie fehlt ihnen Gott. Hätte ihr Beziehungsverhalten von Gott her inspiriert werden sollen, so hätte ihnen der Anfang jeder christlichen Existenz geschenkt werden müssen, das: „Jesus ist der Herr“ (2 Kor 4,5). Papst Franziskus beschreibt die Erstverkündigung, auf die alles andere (und erst recht Moraltheologie) aufbaut, so:
„Jesus Christus liebt dich, er hat sein Leben hingegeben, um dich zu retten, und jetzt ist er jeden Tag lebendig an deiner Seite, um dich zu erleuchten, zu stärken und zu befreien.“
Warum eigentlich haben Sie auf dem Synodalen Weg die dringende Bitte des Papstes missachtet, „Neuevangelisierung“ zum Thema zu machen? Brecht variierend: Erst kommt das Beten, dann kommt die Moral. Es sei denn, sie verkünden eine gottfreie Moral. Das ist dann aber keine christliche mehr, sondern eine Allerweltsmoral. Darauf läuft es leider hinaus. Christsein ist nicht, ein normales Leben zu führen, zu dem ein frommes Addendum hinzukommt, das man gut einbauen kann in sein individuelles Konzept von „gelingendem Leben“. Seit Abram aus Ur wegging, bedeutet glauben: mit einer fundamentalen Schwerpunktverlagerung von mir auf den mich ansprechenden Gott leben. Was gelingendes Leben für mich ist, weiß ich apriori nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich entdecke es auf einem Weg, auf dem ich mich zusammen mit anderen Christen der Führung Gottes, seinem Wort und seinen offenbaren Weisungen anvertraue.
Nur einer ist der Gute
Christliche Ethik hat einer Ethik ohne Gott zumindest das voraus, zu wissen, wo die Liebe zuhause ist und woher das Gute kommt: „Gott ist Liebe“ (1 Joh 4,8). „Nur einer ist der Gute.“ (Mt 19,17) Indem sich Gott aus einem Überströmen des Guten in der Schöpfung und in die sinnvollen Ordnungen der Schöpfung hinein entworfen hat, ist – wie der Römerbrief sagt – „seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft“ (Röm 1,20) wahrnehmbar. Gleichzeitig spricht Röm 1 von der Rebellion des Menschen, die Gott nicht mehr Gott sein lässt und menschliche Souveränität gegen die Herrschaft Gottes aufrichtet. Das nächstbeste Beispiel, das Paulus anführt für die daraus folgende Unordnung, macht uns heute die allergrößten Schwierigkeiten. Es sind die Verse 1,26 und 1,27:
„Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus: Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen; ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander; Männer trieben mit Männern Unzucht.“
Die Versuche, diese Verse zu entkräften sind Legion: Keiner von ihnen ist befriedigend. Warum wählte Paulus ausgerechnet dieses Beispiel? Frauen, Kinder, Sklaven und Unfreie waren in der Antike Menschen zweiter Klasse. Sex mit halbwüchsigen Jungen gehörte zum kulturellen Repertoire. Es gab Prostitution, Abtreibung, Infantizid, Menschenhandel, polygame, wie polyamoröse „Liebe“ – übrigens auch dauerhaft-symmetrische Beziehungen gleichgeschlechtlicher Art. Ich nehme an, dass für Paulus homosexuelle Praxis für den Verfall der gesamten Schöpfungsordnung stand. Seltsam: Ausgerechnet mit ihrer radikalen Kontrastmoral waren die frühen Christen überaus erfolgreich.
Während die Heilige Schrift auf gleichgeschlechtlichen Sex gar nicht (oder ablehnend) eingeht, ist der Sinn von Ehe reich entfaltet und tief in die christliche Anthropologie eingelassen. Von einem außertheologischen Standpunkt betrachtet, gibt es in der gesamten Antike kein polemischeres und homophoberes Dokument als die Bibliothek der Bücher Alten und Neuen Testaments. Der Exeget N. T. Wright sagt:
„Die frühe und die normative christliche Tradition hebt sich an dieser Stelle gemeinsam mit der großen jüdischen Tradition … vom normalen Ansatz des Heidentums in seinen alten und modernen Formen mit einem strengen ´Nein´ ab. Während der gesamten ersten christlichen Jahrhunderte, als jede Art von Sexualpraktik, die in der Menschheit jemals bekannt war, in der antiken griechischen und römischen Gesellschaft weit verbreitet war, bestanden Christen wie Juden darauf, dass die ausgelebte Sexualität auf die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau zu beschränken sei. Heute wie damals denkt der Rest der Welt, das sei verrückt. Der Unterschied besteht leider darin, dass heute auch die halbe Kirche dasselbe denkt.“
Die Einheit von Monogamie und Monotheismus
Über 2.000 Jahre hinweg hat die Kirche an etwas festgehalten, was sie zum weißen Elefanten im Zoo der Menschheit machte, nämlich am unbedingten Zusammenhang von Monotheismus und Monogamie – man muss sagen: humpelnd und hinkend, mit halbherzigen Kompromissen, unter dem Gelächter immer neuer Generationen und in Anbetracht permanenten Scheiterns. Juden wie Christen verstanden sich als leidenschaftliche, ja feindliche Antithese zum sie umflutenden Polytheismus der Vielvölker.
Polytheismus – das war die Hingabe an die vielen Götter, die Unzucht mit den Baalen. Eifersüchtig wacht Jahwe über die Treue seiner Braut. „Hurerei“, sagt Hans Urs von Balthasar, „ist die wichtigste alttestamentliche Bezeichnung für den Abfall vom wahren Gott, der Israels rechtmäßiger Gatte ist und der sich beklagt, dass Israel unter jedem Busch für einen fremden Gott die Beine spreizt und ihm noch Geld dafür gibt, statt sich bezahlen zu lassen (Ez 16).“ Der monotheistische Identitätskern, der vom Judentum ungebrochen auf das Christentum überging, manifestierte sich im eisern durchgehaltenen, exklusiven Festhalten an der monogamen Ehe und der Verwerfung aller außerehelichen sexuellen Manifestationen als „Unzucht“. Das ist die doppelte Wasserscheide, in der die geforderte Hingabe des einen Volkes an den einen Gott in der Hingabe des eines Mannes an eine Frau gelebt wird. Die gleichzeitige oder serielle Hingabe an die Vielen ist Götzendienst wie „Unzucht“. Wir finden sie in allen Paränesen von Paulus (etwa 1 Kor 6,18) an herausgehobener Stelle, wie auch bei Jesus, wo die „bösen Gedanken“, die „von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen“ eingeleitet werden mit der „Unzucht.“ (Mk 7,21)
„Eheliche Treue“, sagt N.T. Wright, „… ist Echo und Antizipation der Treue Gottes gegenüber der ganzen Schöpfung. Andere Arten von sexueller Aktivität symbolisieren (…) die Entstellungen und den Verfall der gegenwärtigen Welt. Mit anderen Worten: Christliche Sexualethik ist nicht einfach eine Ansammlung alter Regeln, die wir heute locker beiseitelegen können, weil wir es besser wissen.“
Sentiment steht jetzt gegen Argument
Seit die globale sexuelle Revolution unsere Kulturräume überspülte (und in ihrem „dogmatischen“ Kern die Fragmentierbarkeit von Liebe, Ehe, Verbindlichkeit, Treue, Fruchtbarkeit setzte) stehen Kirche und Theologie unter einem immer größeren Anpassungsdruck. Nicht mehr nur kirchenferne oder teilinformierte Gläubige stehen entgeistert vor dem nüchternen Befund, dass Altes und Neues Testament, Jesus und Paulus, die Schrift und die Kontinuität kirchlicher Lehre den authentischen Ort von praktizierter Sexualität exklusiv der Ehe zuweisen. Nun finden sich immer häufiger christliche Mehrheiten jenseits dieser vehementen und eindeutigen Bezeugung. Gegen „alles“ wird zur Entlastung von normativem Druck ein neuer Satz gesetzt: Auch sexuelle Praxis jenseits der Ehe ist gut.
Wo die neuen Ansichten theologisch vertreten werden, geschieht dies unter Aufbietung gewaltiger Armeen von Analyse und Theorie, bis hin zu einer Relecture der gesamten Christentumsgeschichte, die böse sein muss, damit das neue Gute Platz hat. Im Licht universeller Toleranz wird eine Lehre und Weisung gebende Kirche als lust- und menschenfeindlicher Terror vorgestellt. Auf dem Synodalen Weg hält man es für diskriminierend, Christen sexuelle Enthaltsamkeit anzuraten. Argumentativ ist dem nicht beizukommen. Der Satz: Das ist aber falsch, wird beantwortet mit: Du tust mir aber weh! Sentiment steht gegen Argument. Die Offenherzigeren unter den Vertretern einer neuen Sexualmoral, bekennen freimütig, dass dieser Ansatz nur zum Preis eines Bruches mit der gesamten Kontinuität der Kirche zu haben ist. Ob dies möglich sein kann, ohne eine neue Kirche gegen die alte zu setzen, – darum geht der Streit, und nicht um ein paar Optimierungen im Katechismus.
Kirche kann nicht heiligen, was Gott nicht heiligt
Nun kann man sich mit Gründen fragen, ob die „neue Sexualmoral“ überhaupt eine Moral ist, – oder ob sie nicht eher eine identitätspolitische Kampagne zur postfaktischen Rechtfertigung dissidenter sexueller Lebensentwürfe im Raum der Kirche darstellt. Moral kann nun aber nicht darin bestehen, so lange an der Normenschraube zu drehen, bis auch meine sexuelle Praxis den Interpretationsrahmen findet, in dem es irgendwie als „moralisch“ durchgeht. Das würde „Moral“ zum ideologischen Überbau der realen Lebensverhältnisse machen. Und es würde bedeuten: sie zu zerstören. Die nachträgliche Heiligsprechung bestimmter Lebensstile ist nicht Moral, sondern Moralismus oder Hypermoral. Die Kirche kann übrigens nichts heiligsprechen, was nicht heilig von Gott her ist, allenfalls kann sie dogmatisch die existenzielle Ratifizierung von Gott geschenkter Heiligkeit feststellen. Nun aber gilt: Ich lasse mir von niemand etwas sagen, was ich nicht selber weiß und will. Ich bin der Souverän meines Lebens; ich bin meine Natur; ich bin meine Moral.
Das Kennzeichen echter Moral ist, dass sie sich gegebenenfalls gegen mich wendet. Moral hilft, das Gute von jenem Bösen zu unterscheiden, das mich zu meinem Schaden bestimmt. Moral besteht dann in flankierenden Maßnahmen, die zur Erlangung des Guten erforderlich sind. Das ist tief im Menschlichen verankert. Moral ist weder eine Erfindung noch eine Vereinbarung unter Moralbesitzern. Moral wird entdeckt in Anstand, Sitte, Gebräuchen, vormoralischen Instanzen wie dem Tabu usw. Die ethische Vernunft läutert und fasst nur, was dem Guten zur Verwirklichung verhilft.
Eine wirklich zukunftweisende Ethik ist heute Tugendethik, wie sie im Anschluss an Aristoteles von modernen Ethikern wiederentdeckt wird. Sie ist präfaktisch zur Stelle, d.h.: bevor das Kind im Brunnen liegt. Vor unverbindlichem Sex. Vor dem Nein zum ungeborenen Kind. Vor dem Ehebruch. Sie löst den moralischen Konflikt nicht durch permissive Umfirmierung. Sie stärkt das Starke in der Schwäche, weckt das positive Potential im Menschen. Sie ist fehlerverzeihend und hilft Menschen, ihr Glück im immer besseren Vollbringen des Guten zu erlangen.
Umfirmierung des Bösen zum Guten
Seltsamerweise ist die „neue Sexualmoral“ old school – immer noch auf die Kasuistik von „erlaubt“ und „verboten“ fixiert. Strukturell von gleicher Bauart, inszeniert sie sich als Bestimmungsmacht über Gut und Böse, – nur, dass man heute ein bisschen mehr von dem erlauben möchte, was gestern untersagt war. Vorehelicher Sex? Gestern verboten. Heute okay! Heute normal! Masturbation? Gestern mit Warnschildern versehen. Heute ein empfehlenswerter Umgang mit der eigenen Lust! Vor allem möchte man mit höchstem intellektuellem Triebdruck die Wertschätzung homosexueller Praktiken in die Kirchenbücher einschreiben. Der Entwurf einer neuen Sexualmoral ist wie ein Rad um die Nabe von Homosexualität gebaut. Im Übergang der Sexuellen Revolution zu pansexueller Ermächtigung („Menschenrecht auf Sex“) war schon einmal die promiskuitive Logik von Homosexualität der Treiber der Entschränkung vom christlich einen auf die heidnisch vielen Sexualpartner. Wenn die Sexualität biologisch gesehen primär der Funktion dient, den Fortbestand der Menschheit zu garantieren, dann ist Homosexualität der Sonderfall und nicht die Regel. Wer aber die Ausnahme zur Regel macht, macht die Regel zur Ausnahme. Der Standpunkt lenkt den Diskurs und präjudiziert das Ergebnis.
2. Anthropologisch gesehen …
Der Auslöser zur Debatte um eine neue Sexualmoral war die Paralysierung der gesamten Kirche durch die Missbrauchskrise und ihrer organisierten Vertuschung durch die Hirten der Kirche und ihre Bevollmächtigten. Der Bischof aber, der heute vom „unsäglichen Leid der Betroffenen“ spricht, meint nicht etwa das Drama der sexuell Missbrauchten. In aller Regel meint er den von der alten Sexualmoral der Kirche terrorisierten homosexuellen, bisexuellen, diversen Menschen. Als Betroffener von gleichgeschlechtlichem sexuellem Missbrauch in der Kirche nehme ich wahr: In einem Moment, in dem nicht einmal ansatzweise geklärt ist, wie es dazu kommen konnte, dass (nirgendwo sonst, aber ausgerechnet) in der Katholischen Kirche die vergewaltigenden Übergriffe zu 80 Prozent von Männern an halbwüchsigen Jungen vorgenommen werden – in diesem gleichen Moment beschreibt der Synodale Weg Homosexualität als „Normvariante von Sexualität“ und „gute Schöpfungsgabe Gottes“. Wenn ich mit biographischem Hintergrund auf diesen ungeklärten Punkt hinweise, werde ich als „homophob“ beschimpft. Gleichgeschlechtlicher Missbrauch ist ein Typus, der wie kein anderer Missbrauch derzeit in den Schatten gerückt und ausgelöscht wird, weil alles überblendet wird von Versuchen, der Diversität sexuellen Begehrens gerecht zu werden, dieses Begehren zu entsündigen und es ins Licht von Normalität und Schönheit zu stellen. Indem ich das Thema aufgreife, lasse ich mich nicht nur für die (im großen Ganzen der Gesamtgesellschaft) vergleichsweise wenigen Opfer klerikalen Missbrauchs prügeln. Ich kämpfe auch für die Opfer der zwanzig Lehrer an der Odenwaldschule, auch für die Opfer der ehemaligen Lichtgestalten sexueller Aufklärung: Alfred C. Kinsey, Michel Foucault und Helmut Kentler.
Laufend werden zur Fundierung der neuen Moral „humanwissenschaftliche Erkenntnisse“ vorgebracht, aber nicht vorgelegt. Wo sie vorgelegt werden, sind sie hypothetisch oder falsch, jedenfalls nicht Wissenschaftskonsens. Die auf dem Synodalen Weg vorgelegten Texte beweisen eine erstaunliche Unkenntnis (oder Ignoranz?) der neueren sexualwissenschaftlichen Literatur zur individuellen Genese und biographischen Stabilisierung sexueller Einstellungen.
„Um Gottes Willen, lassen Sie die Finger davon“
Um es mit Erfahrungen zu illustrieren: Aufgrund einer Publikation zu sexuellem Missbrauch, lud mich ein Ordensmann ein, um mein Verständnis von Homosexualität zu vertiefen. Ich fuhr hin, wie ich mich auch mit anderen Menschen gleichgeschlechtlicher Neigung traf, um die Realität besser kennenzulernen. Wir kamen auf den Katechismus zu sprechen. Sollte man nicht einfach versuchen, die Pkt. 2357 – 2359 weniger „diskriminierend“ zu fassen? Sehr zu meinem Erstaunen meinte der Mann: „Um Gottes willen, lassen Sie bloß die Finger davon. Besser, als es dort steht, kann man es kaum sagen! Mit Diskriminierung hat das nichts zu tun.“
In mein Erstaunen hinein erzählte er mir seine Geschichte. Sexuell unsicher wählte er den Orden – vielleicht, um der individuellen Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität zu entgehen. Dort entdeckte er seine Neigung zum eigenen Geschlecht, begann eine sich hinziehende sexuelle Liaison mit einem Mitbruder, um darin aber nicht die Erfüllung seines sich verstärkenden Begehrens zu finden. Immer öfter erbat er sich die Schlüssel zum Wagen der Gemeinschaft, um heimlich Orte aufzusuchen, an denen es namen- und gesichtslosen Sex gab. Man sah ihn, meldete ihn der Ordensleitung, sorgte dort für eine Psychotherapie. Sie führte zu zwei Einsichten: 1. … wie unglücklich der Mann war; 2. … dass sein Begehren mehr mit einem sklavischen Suchtverhalten als mit echter Liebe zu tun hatte. So tat er spät, was er in seiner langen chaotischen Suche nach Erfüllung nicht getan hatte. Er vertiefte seinen Glauben und entschied sich für ein nicht leichtes Leben in Enthaltsamkeit und in nicht sexuell konnotierten Freundschaften. Zitat: „Es ist mein Kreuz, dass ich zu tragen habe. Aber ich habe zu mir gefunden. So kann ich gut leben.“
Debatten abseits realer Soziostrukturen
Die Virulenz dieser Nachtseite männlicher Homosexualität wird durch alle einschlägigen Studien bestätigt; man findet sie im öffentlichen Erstaunen über die verhängnisvollen Verstrickungen eines Volker Beck, man findet sie in der Literatur – bei André Gide, Hubert Fichte, den Tagebüchern von Julien Green, Thomas Mann … – und man findet sie in der Unterscheidung zwischen „sozialer“ und „sexueller Treue“, die all überall reklamiert wird, wo man mit homosexuellen Männern spricht. Und man findet sie – übrigens bis zur Stunde – auf der Homepage des Bistums Limburg, wo sich ein Laienjugendseelsorger verbreitet, der sich erst dann von der Kirche angenommen fühlt, wenn diese auch seine wechselnden Sexualpartner akzeptiert. Nun stellt uns der Synodale Weg einen Typus von Homosexualität vor, dessen Strukturierung sich dem Bild der Ehe von Mann und Frau verdankt: personal durch Liebe verbunden, symmetrisch vereinbart, treu, (lebenslang?) verbindlich verbunden, tief im Glauben verankert. Ein Betroffener, mit dem ich gesprochen habe, hält diesen Typus aber „mindestens bei Männern eher für ein Konstrukt“; ein anderer meinte: „Wenn Sie danach in Deutschland suchen, passen die auf ein Fußballfeld!“
Kann es der Kirche aber nur um die verschwindende Minderheit gehen, die sich der kirchlichen Kriteriologie öffnen möchte? Schon meldet sich der bei den Jesuiten ausgebildete, schwule Philosoph Ruben Schneider, um sich über die bloße Symbolpolitik der Segnungsfeiern zu beklagen: „Es handelt sich um eine Fortführung traditioneller, exklusiver und heterosexuell normierter Paarungsmuster, und dadurch wird im Endeffekt die Strukturierung bzw. prinzipielle Diskriminierung vielfältiger Lebens- bzw. Liebensformen nach heterosexuellem Muster weiter ausgebaut: Ein gutes Paar ist nur ein verheiratetes Paar – kein nicht-verheiratetes Tripel, kein Polygam und auch keine andere Lebensgemeinschaft´.“
Von der Möglichkeit, sich als divers eintragen zu lassen, machten in 2019 etwa 150 Personen Gebrauch. 8.700 Personen entschieden sich für eine „Ehe für alle“. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind das: 0,01088 Prozent. Von diesen 0,01 Prozent geht es aber, fasst man die kirchliche Zielgruppe ins Auge, weitere Kommastellen nach hinten, rechnet man wie gesagt die heraus, die nicht gläubig sind, oder für sich auf der Unterscheidung zwischen sozialer und sexueller Treue bestehen.
Das soll nicht die Bemühungen kirchlicher Stellen lächerlich machen, die sich um die Humanisierung apersonaler und promiskuitiver Lebensstile bemühen. Mit einigem Aufwand organisiert man in deutschen Diözesen „queersensible Seelsorge“. Wer Menschen kennt, die mit ihrer geschlechtlichen Identität Probleme haben, weiß, dass sie sich nach nichts mehr sehen, als Freundschaft zu erfahren und angenommen zu werden. Dabei muss die Kirche allerdings zwei Faktoren beachten: a) die Empirie, b) die Heilige Schrift.
3. Empirisch betrachtet ….
Homosexualität ist ein unglaublich vielschichtiges Phänomen, wie übrigens auch Heterosexualität. Das vermeintliche Gegensatzpaar stellt sich bei näherer Betrachtung als eine Begriffskrücke aus dem 19. Jahrhundert dar, die der Fluidität sexueller Entwicklungsgeschichten und Selbstinterpretationen nicht gerecht wird: Das ist das Körnchen Wahrheit an der Gendertheorie. Was die synodalen Papiere dazu darbieten, sind manchmal Pauschalisierungen, dann wieder Verfälschungen von Tatsachen, oder es werden widersprüchliche Aussagen als Gewissheiten vorgetragen. Um mit einem offenkundigen Widerspruch zu beginnen. So heißt es im Handlungstext zur Neubewertung von Homosexualität: „Zu jeder menschlichen Person gehört untrennbar ihre sexuelle Orientierung. Sie ist nicht selbst ausgesucht und sie ist nicht veränderbar.“
Was nun: Wählbar oder nicht wählbar?
Die „Natürlichkeit“ und Unveränderbarkeit homosexueller oder bisexueller Orientierung ist zwar standardisierte, sexualdeterministische Selbstwahrnehmung in der Szene. Sie wird aber von keiner der neueren sexualwissenschaftlichen Studien gestützt, wo man ein höchst differenziertes Bild vom Zeitpunkt der Entstehung, den multifaktoriellen Einflüssen und den Mutationen einer bestimmten Selbstzuschreibung sexueller Identität dargeboten bekommt. Von traumatischen Erlebnissen oder konfliktiven sozialen Konstellationen ist ebenso die Rede wie etwa von den Wirkungen des Konsums immer härterer Pornographie.
Um es wieder durch die Begegnung mit einer betroffenen Person zu illustrieren: Teresa Frei, die Autorin von „Frauen lieben. Eine lesbische Suche nach Gott“ bewegte sich Jahrzehnte in der Szene und lebte in queeren Wohngemeinschaften; sie sagte mir: „Wir haben permanent über Identität gesprochen; eigentlich hatten wir kein anderes Thema, auch wenn wir dabei paradoxerweise mögliche Zusammenhänge und Ursachen nicht zur Sprache bringen wollten. Aber ich habe in all den Jahren nicht einen einzigen unter all meinen Freunden und Freundinnen gefunden, hinter dessen Orientierung nicht ein Narrativ stand.“ Das meint: eine Erklärung, ein Auslöser, eine Konstellation, eine seelische Wunde, eine Zurücksetzung, ein Erlebnis, ein biographisches Detail.
Um auf den „Handlungstext“ zu kommen: Wo man von genetischer Bestimmung zur Homosexualität ohnehin nicht sprechen kann, allenfalls von einer gewissen Disposition in bestimmten Fällen, hält der Text noch immer die Legende vom schicksalshaft verfügten „ich war schon immer so“ aufrecht, was in Einzelfällen durchaus sein mag. Gleichzeitig sagt aber der Handlungstext „Ja“ zur Gendertheorie, – einer Theorie, die im Kern von der Fluidität geschlechtlicher Identität und vom Recht auf autonome Selbstbestimmung ausgeht und daraus die freie Wähl- und Veränderbarkeit sexueller Identität ableitet.
Also was nun? Nicht wählbar? Oder wählbar? Ich bin, was ich sein muss? Oder: Ich bin, was ich sein will? Hier wird in schönem Nebeneinander eine neue Art von „Naturrecht“ postuliert und es gleichzeitig geleugnet. Die klassische Anthropologie antwortet vermittelnd: Wähle, was du von Natur aus sein sollst. Das ist vernünftig, übrigens auch konkordant mit der Schöpfungslehre.
„Meine Sexualität bin ich“?
Im Ganzen scheinen die Texte des Synodalen Weges diesem neuen, freilich ausschließlich individuellen „Naturrecht“ diverser Identität zuzuneigen. Von einer gemeinsamen Natur könne keine Rede sein: Meine Natur ist mein Begehren. Mein Begehren ist meine Sexualität, oder wie es Bischof Helmut Dieser einmal – wie ich meine: überaus schlicht – formuliert hat: „Meine Sexualität bin ich.“ Der Sinn des Diktums ist klar: Das Naturwüchsige muss man auch leben – genauer gesagt: schuldlos ausleben – dürfen. Ethische Anfragen, Urteile oder gar Verbote wären dann naturdestruktiv, rechtswidrig und diskriminierend.
Sollte es aber möglich sein, gutes Handeln aus einem je eigenen, quasi naturwüchsigen Begehren abzuleiten? Die Antwort kann nur lauten: Um Gottes willen, nein! Machte man das faktische sexuelle „Begehren“ zum archimedischen Punkt der Ethik, wäre Homosexualität zwar irgendwie „natürlich“. Aber dann wäre jedes Begehren „natürlich“. Beispiel: Laut einer Emnid-Umfrage von 2000, bezeichneten sich 1,3 bzw. 0,6 Prozent der in Deutschland Befragten als schwul bzw. lesbisch, sowie 2,8 bzw. 2,5 Prozent als bisexuell. 22 Jahre und viele Millionen Werbeminuten für „Vielfalt“ später könnten es ein paar mehr sein (insbesondere schnellen ja gerade die Zahlen von Frauen hoch, die sich als „lesbisch“ beschreiben), aber an den Verhältnissen dürfte sich nichts geändert haben: Es gibt mehr als doppelt so viele Menschen, die sich als „bisexuell“ verstehen, als solche, die sagen, sie seien „homosexuell.“
Zu Menschen mit bisexueller Identität heißt es im Text: „Bei Homosexualität und Bisexualität handelt es sich weder um Krankheiten oder Störungen noch um etwas, was man sich aussuchen kann. Vielmehr stellen sie natürliche Minderheitsvarianten sexueller Präferenzstrukturen von Menschen dar.“ Natürlich? Heißt das, meine Frau darf ihre plötzlich entdeckte bisexuelle Identität ausleben? Ersparen wir uns den Rattenschwanz aller Formen von „Begehren“, die nach Ausleben schreien. Gerade versuchen die Pädophilen wieder in der Queer-Szene Fuß zu fassen. Sie wollen ihr „Begehren“ halt auch leben. Möchte ich nicht verstehen, und daran erinnern, dass die klassische Anthropologie eine nicht ganz unkluge Unterscheidung zwischen „geordnetem“ und „ungeordnetem“ Begehren machte. Aber da sind wir schon in der Theologie, wovon zum Abschluss die Rede sein soll.
Vielfalt, Gender und Unfug
Zuvor müssen wir uns aber – um auch die Sympathie für Gender und die Vielfalt der nichtbinären „Geschlechter“ zu beleuchten – noch aus naturwissenschaftlicher Sicht mit dem Thema sexuelle Identität befassen, wobei wir uns der Dienste der Biologin und Nobelpreisträgerin Christine Nüsslein-Vollhardt versichern. Bei „Emma“ konfrontiert mit der Annahme einer Vielzahl von Geschlechtern, meinte sie: „Das ist Quatsch! Es ist Wunschdenken. Es gibt Menschen, die wollen ihr Geschlecht ändern, aber das können sie gar nicht. Sie bleiben weiterhin XY oder XX.“ Und als man sie auf das sogenannte „dritte Geschlecht“ ansprach, korrigierte sie: „Intersexualität entsteht durch sehr seltene Abweichungen, zum Beispiel beim Chromosomensatz. Aber auch intersexuelle Menschen haben die Merkmale beider Geschlechter, sie sind kein drittes Geschlecht.“ Man darf es für ein Verbrechen halten, die normalen sexuellen Irritationen vierzehnjähriger Mädchen auf Hormonblocker und Chirurgen zu lenken, indem man ihnen sagt: „Fühle doch mal in dir nach! Vielleicht bist du in Wirklichkeit ein Mann oder noch ganz etwas Anderes.“
Aber gibt es nicht Männer, die sich wie Frauen fühlen und umgekehrt? Und gibt es ihn nicht, diesen Menschen, der sich in einer Talkrunde des BR vorstellte: Ein Mann, der sich wie eine Frau fühlt, aber verheiratet ist mit einer Frau, die sich wie ein Mann fühlt? Kommen Sie noch mit? Noch einmal Nüsslein-Vollhardt: „Natürlich. Es gibt sehr ´feminine´ Männer und sehr ´maskuline´ Frauen, was nicht nur mit kulturellen Faktoren, sondern unter anderem auch mit unterschiedlichen Hormonleveln zu tun hat. (…) Menschen behalten lebenslang ihre Geschlechtszugehörigkeit. Natürlich kann man durch Hormongaben erreichen, dass zum Beispiel ein Mädchen, das Testosteron nimmt, eine tiefe Stimme und Bartwuchs bekommt. Aber davon wachsen dem Mädchen keine Hoden und es wird keine Spermien produzieren. Und biologische Männer produzieren auch durch Hormongaben keine Eier und können keine Kinder gebären.“
Es ist ratsam, dass die Moraltheologie nicht von der Empirie abweicht und ihre Ethik auf ideologischen Annahmen aufbaut. Und genau das wollen Sie mit Nachdruck kirchlich durchsetzen. Wissenschaftlich haltlos behaupten Sie, das Lehramt missachte „weitestgehend Erkenntnisse aus Psychologie, Medizin und Anthropologie, nach denen Geschlecht auch nicht-binäre Varianten kennt.“ Bis zum Beweis des Gegenteils gibt es keine nichtbinären Geschlechter.
4. Theologisch betrachtet …
Kommen wir abschließend zu Moral-Theologie. Entgegen anderslautenden Auffassungen funktioniert sie nicht ohne den Faktor Gott. Das weiß auch Bischof Helmut Dieser, der in einem Interview bekannte: „Homosexualität ist keine Panne Gottes, sondern gottgewollt, im selben Maß wie die Schöpfung selbst.“ Es sekundiert Bischof Peter Kohlgraf: „Niemand ist ein Schadensfall der Schöpfung, alle sind geliebt, Gott hat sie alle so gewollt.“ Auch der Trierer Bischof sieht den homosexuellen Menschen als „schöpfungsgewollt“. Diese medial applaudierten Aussagen sind denkwürdig, weil sich in ihnen das menschlich nett Gemeinte auf fatale Weise mit einer theologischen Korrumpierung mischt, die sich in gleicher Weise in Ihrem „Grundtext“ wiederfindet, wenn es dort von der Homosexualität heißt: „Sie ist eine Normvariante und keine ´Minus-Variante´ (…) Sie gehört als Normalfall zu Gottes guter Schöpfung.“
Noch ein paar unentdeckte Schöpfungsideen Gottes?
Das muss man bestreiten, und zwar genau mit dem Argument, das klassisch an dieser Stelle vorgetragen wurde. Die Weise wie Menschen – übrigens alle Menschen – ihr Menschsein und ihre Sexualität erleben, ist gebrochen; wir erfahren eine durch „Erbsünde“ korrumpierte Realität jenseits des Paradieses. Unsere Idealität und unser Seinsollen lesen wir nur mühsam oder gar nicht aus unserer Gebrochenheit heraus, sinnvollerweise aber auf den Schöpfungswillen Gottes hin.
Sollten sexuelle Identitäten, in denen die wechselseitige Verwiesenheit der Geschlechter nicht stattfindet, gewissermaßen vor paradise lost und jenseits von Gen 1,27 („Männlich und weiblich erschuf er sie“) seinen Platz finden? Sollten alle queeren „Identitäten“, sollten Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität, Intersexualität „Vollkommenheiten“ sein, die unter Gen 1,31 fallen: „Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, sehr gut war«? Gehört das alles zu den geschaffenen Werken, in denen sich die Weisheit, Güte, Gerechtigkeit und Schönheit Gottes widerspiegelt? Gehört das in identischer Tiefe zum Menschen, der zum „Ebenbild Gottes“ (Gen 1,26) berufen ist? Ist das Nicht-ein Fleisch-werden-können des Verbleibens im ausschließlichen Bezug auf das eigene Geschlecht eine noch unentdeckte Schöpfungsidee Gottes? Ist die Weise, wie ich mich faktisch erlebe, deckungsgleich mit der Idee, die Gott von mir hat? Ist das alles nicht vielmehr Ausdruck eines Fragmentarischen, einer passion inutile, eines Mangels am Vermögen, das eigene Geschlecht zu überschreiten, um in der Komplementarität der Geschlechter fruchtbar und dem Schöpfer ähnlich zu werden?
Natürlich möchte kein Mensch eine „Minus-Variante“ sein und zu den Armen, Verkrüppelten, Lahmen und Blinden gehören, die in Lk 4,13 am Ende noch an den Tisch gebeten werden. Da sind wir bei unseren drei Bischöfen, die diese offene Wunde, am Punkt der geschlechtlichen Orientierung irgendwie nicht für voll genommen zu werden, in Gott hinein verlagern, indem sie die Wunde zur Nichtwunde deklarieren und dann sagen: Gott will das. Gott will dich so.
Das Gegebene ist nicht das „sehr gute“
Will Gott die Blindheit des Blindgeborenen? Will Gott die Fehlbildung der Wirbelsäule bei einem Menschen, der mit offenem Rücken geboren wird? Würde Gott, der Schöpfer, das wirklich wollen, – seine Schöpfung wäre eine sinnfreie, von Gott nichts verratende Emanation. Oder Gott wäre nicht Gott, sondern ein Monster, in dem es den Willen zum Bösen gibt. Gott wäre böse. Gott kann aber nicht böse sein, ohne sich zu negieren. Das faktisch Gegebene meiner Existenz ist nicht identisch mit dem „sehr gut“ der Schöpfung. Der Blindgeborene ist zwar blind geboren, aber nicht blind erschaffen. Er wird auch nicht in Blindheit erlöst; er ist zum Sehen, ja zur Anschauung Gottes bestimmt. Die Blindgeborenheit des Blindgeborenen macht ihn auch nicht zu einer Minus-Variante des Menschlichen – und so ist auch die Homosexualität des Homosexuellen keine „Minus-Variante“ des Menschlichen, sondern ein Zeichen sexueller Gebrochenheit, unter der übrigens alle Menschen leiden.
Was ist die Lösung, so werde ich häufig mit Verweis auf die Leiden der Menschen gefragt, die sich in der kirchlichen Matrix der Liebe nicht wiederfinden. Meine Antwort: Es gibt keine Lösung jenseits der Pastoral im forum internum. Keine allgemeine Regel wird der Vielgestalt der Phänomene gerecht. Es war und ist ein Kardinalfehler, die Möglichkeit einer kirchenoffiziellen Gesamtlösung zu verheißen, gar eine neue Moral in den Katechismus einschreiben zu wollen. Das wird nicht gelingen. In der Zurückweisung des Anspruchs wird man Menschen nachhaltig frustrieren, sie noch tiefer verletzen. Im forum internum aber kann man genau das machen, was eine pauschale Habilitierung der endlosen Varianten sexuellen Begehrens in Lehre und Leben der Kirche nicht leisten kann. Verschließt man durch eine beschwichtigende neue Theorie jeden Weg in den Dialog, der nur im forum internum möglich ist, wird man niemals das unauflösliche Knäuel einer konkreten Geschichte daraufhin anschauen können, was daran Freiheit und was determiniert, – was Mangel, Irrtum, Krankheit, Schicksal, Missbrauch, Schuld und Sünde ist. Und man wird, was daran katastrophisch gegen Gott aufgerichtet wurde, nicht einmal mehr beichten können, wo doch Heilung von Gott und Versöhnung mit ihm die befreiende Wende von oben bedeuten könnte.
Die „Jesuslösung moralischer Konflikte“
Im forum internum könnte sich ereignen, was ich einmal die „Jesuslösung moralischer Konflikte“ genannt habe. Wir finden sie in Joh 8,1ff. Es ist die Stelle, an der man die Ehebrecherin vor Jesus schleppt, um ihm eine Falle zu stellen. Eben diese Falle stellt sich die Kirche gerade selbst, indem sie entweder zum Verurteilen oder zur Kooperation gezwungen wird. Die Lösung Jesu erfolgt in einem Vierschritt.
Erstens: Kirche, schreibe mit dem Finger in den Sand! Lasse dich nicht missbrauchen zum Partei ergreifen, zum Brandmarken, zu öffentlichen Verurteilungen und Diskriminierungen. Zweitens: Kirche, schlage der Menge die Steine aus der Hand! Erinnere alle an die Sündhaftigkeit aller. Lass sie verstehen, dass sie den Sündenbock vernichten wollten, der sie selbst entschulden sollte.
Drittens: Kirche, nimm in Barmherzigkeit an! Schau den Menschen ins Gesicht. Frage nach Namen und Geschichte. Und mache einen Unterschied zwischen dem Gesetz und Gott, der größer ist als das Gesetz.
Viertens: Eröffne neues Leben! Entlasse in Frieden und erinnere diskret, dass Gottes Liebe annehmen heißt: die Sünde verabschieden.
Kein guter Dienst am Menschen
Fazit: Es kommt eine Menge zusammen: Eine in ihren Grundlagen unsichere, schriftferne Theologie, die sich durch Gefälligkeiten auf Augenhöhe mit der Moderne bringen möchte, betreibt ihre eigene Auflösung. Sie startet beim rapiden Verfall der Beziehungswelten nach der Sexuellen Revolution, tauft das mit „Lebenswirklichkeit heute“, kniet vor einer falschen Autonomie menschlicher Freiheit, nährt sich von Pathos einer ebenso falschen Betroffenheit. Statt das Leben am Wort Gottes zu orientieren, dreht sie Gott das Schöpfungswort im Mund herum und zerlegt die Schöpfungsordnung. Sie erweitert die Offenbarungsquellen, damit passt, was passen soll. Sie unterminiert die Natur und das Natürliche, steigt aus den Bundesschlüssen Gottes aus, ignoriert die Manifestation von Wesen und Wollen Gottes in den Geboten, macht aus der Moral ein Stück Identitätspolitik, kehrt sich ab von der kontinuierlichen Lehre der Kirche; und beugt am Ende auch noch kirchliches Recht.
Das sind so ein paar Gründe, warum ich, Frau Mock, nicht meine, dass Sie den Menschen und der Kirche mit Ihrer „neuen Sexualmoral“ einen guten Dienst erwiesen haben.
Diesen Beitrag als Druckversion herunterladen unter diesem Link.
(c) Foto: Synodaler Weg/Maximilian von Lachner
Bernhard Meuser
Jahrgang 1953, ist Theologe, Publizist und renommierter Autor zahlreicher Bestseller (u.a. „Christ sein für Einsteiger“, „Beten, eine Sehnsucht“, „Sternstunden“). Er war Initiator und Mitautor des 2011 erschienenen Jugendkatechismus „Youcat“. In seinem Buch „Freie Liebe – Über neue Sexualmoral“ (Fontis Verlag 2020), formuliert er Ecksteine für eine wirklich erneuerte Sexualmoral.