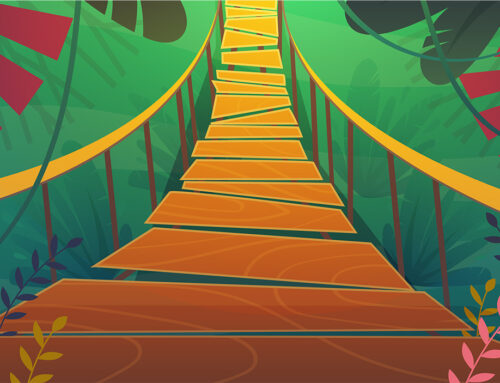Daniel Bogner, Popstar der deutschen Moraltheologen, will die Sexualmoral aufs 21. Jahrhundert trimmen. Das geht gründlich schief. In einem Buch („Liebe kann nicht scheitern“, Herder 2024) und vielen Interviews wirbt er dafür. Weil die Konsequenzen nicht human sind, muss man ihm widersprechen. Bernhard Meuser antwortet launig und präzis auf Bogners Interview im Publik-Forum.
Darf die Liebe alles?
„Darf die Liebe alles?“ lautet die Überschrift des großen Artikels von Daniel Bogner in Publik Forum.
Die Liebe darf alles, was dem Wesen der Liebe nicht widerspricht. Ausschließlich alle Probleme der Sexualmoral resultieren aus der Etikettierung von fragmentierten oder missbräuchlichen Formen von „Liebe“ als „Liebe“.
Lange, heißt es im Teaser, habe die Kirchen versucht, „Sexualität zu regulieren und zu kontrollieren.“ Das sei gescheitert – „zum Glück.“ Bogner versucht sich deshalb an einer neuen „Ethik des Begehrens.“
Dass die Kirche regulative Orientierungen zum Sexualverhalten gegeben hat und noch immer gibt (… sich dabei nicht immer glücklich angestellt hat), hat primär mit den normativen Orientierungen aus der Heiligen Schrift und dem ethischen Kerygma Jesu zu tun. Überdies gibt es seit der Frühgeschichte der Menschheit keine einzige Kultur oder Religion, die Lebensordnungen der Liebe nicht durch Restriktionen geschützt hat. Deregulierungen dieser Lebensordnungen sind häufig mit Formen kulturellen Niedergangs verbunden.
Bogner möchte „nicht einfach als Wissender auftreten.“ Von Liebe und Begehren zu sprechen, das berühre das Höchstpersönliche, wovon wir „alle betroffen sind, in tiefsten Sehnsüchten, existenziellen Ängsten und in den eigenen Bedürfnissen.“ Deshalb schreibe er „als Mensch“ mit ganz intimen, eigenen Wegerfahrungen.
Lebensordnungen der Liebe sind zugleich höchstpersönlich, wie sie höchst sozial sind, weil sie den Anderen betreffen: Ehepartner, Kinder, Familien, die Gesamtgesellschaft. Außer im Fall der Selbstliebe, betrifft die Liebe immer den Anderen – Gott, den oder die Menschen, auf die sich mein Liebesbegehren richtet; von ihm kann man rational feststellen, ob es gerecht oder ungerecht ist. Das ungerechte Bedürfnis ist ja gerade die Materie von Missbrauch, Übergriffigkeit, Instrumentalisierung, – also das, wozu man die Schutzfunktion von Moral benötigt. Weder kann man Bedürfnisse individualistisch isolieren, noch ist ein Skeptizismus in der Liebe angebracht, als sei der begehrende Mensch eine einsame Insel, zu der es noch keine Landkarte gibt.
Sichtlich vom Eigenen ausgehend, spricht Bogner von Glückserfahrungen – von Liebe, Vaterschaft, Familie –, aber auch von Herausforderungen: „Erfahrungen des Stolperns, des verzweifelten Suchens nach möglicher Gemeinsamkeit und der Entscheidung zu getrennten Lebenswegen.“ Scheitern wird sichtbar. Darin macht man „Erfahrungen der Suche, wie Neues möglich sein kann und wie sich Verantwortung inmitten sich ändernder Lebenssituationen ausbuchstabiert.“
Wie wahr! Eindrucksvoll, dass Bogner das Drama seiner unmittelbaren Umgebung nicht ausspart. Zu lange hat Theologie subjektlos gesprochen, sich im Gehäuse vermeintlicher Objektivität verschanzt. Wir sind gespannt, wie er mit der Frage des Scheiterns umgeht!
Gutes Leben auf krummen Wegen
Für Bogner gehört es zu den Herausforderungen seines Vaterseins, seinen Kindern zu vermitteln, „dass man ein liebender, sehnender und sich darin entwickelnder Mensch ist …“, auch „… wenn das Leben keine geraden Wege nimmt.“
Wie schön! Man wüsste nur gerne: Denkt Bogner hier an andere oder denkt er an sich? Sagt er das aus tiefster Empathie, herzlicher Barmherzigkeit mit allen, die im Drama ihrer Liebesversuche „aussteigen“? Oder spricht er von seiner eigenen Ehe? Hat er vielleicht eine „neue Liebe“ gefunden?
Jedenfalls wechselt Bogner aus der ersten Person Singular in den Plural: „Sexualität prägt unser emotionales Erleben, unsere Identitäten und sozialen Interaktionen. Sie ist ein existenzieller Kraftort und ein verwundbarer Punkt.“ Unvermutet schnell sind wir im Politischen: Sexualität habe das Potenzial, Gesellschaften zu formen und zu spalten – „wie die Debatten um LGBTQ-Rechte es zeigen.“
Sanft gleiten wir auf das Terrain hinüber, auf das Bogner unsere Aufmerksamkeit lenken will: auf die Frage der Identität. Gibt es da Vorgaben, zu dem, was ich bin und was ich sein sollte – als Mensch, als Mann, als Ehemann, als Vater? Oder bin ich das, wozu ich mich frei bestimme? Identität – klassisch theologisch auf den Begriff gebracht – heißt: Ich bin das, als was mich Gott erschaffen und wozu er mich gesandt hat. Ursprüngliche Bestimmungen zu unserer menschlichen Identität finden wir sowohl in der Selbstbetrachtung vor dem Ganzkörperspiegel wie im Buch Genesis. In der Debatte um die sogenannten LGBTQ-Rechte tritt nun ein voluntaristischer Begriff von Identität auf den Plan, wonach „ICH“ etwas sein könnte, was weder vor dem Spiegel noch im Buch Genesis zu finden ist.
Sex, meint Bogner, sei nirgendwo „nur Privatsache“, vielmehr ein ewiges Thema in allen Religionen, dazu seien „sexuelle Normen und Moralvorstellungen … eng mit gesellschaftlichen Werten und Identitäten verknüpft.“
Hier wird es heikel – bei der Frage nämlich, wie „gesellschaftlich“ unsere sexuellen Normen und Wertvorstellungen sind. Ist die Ehe ein gesellschaftliches Produkt, vielleicht nur eine Marotte des bürgerlichen Zeitalters? Oder ist sie etwas Überzeitliches, Unbedingtes, gar die Essenz der geschlechtlichen Liebe? Gibt es ein „Wesen“, eine „Natur“ von Mann, Frau, Ehe, Familie? Oder vereinbaren wir das nur? Liegen Menschen existenziell daneben, wenn sie sich die Freiheit nehmen, ihre eigene „Natur“ zu definieren und nach ihrer Façon leben? Müssen wir uns vor der Andersheit des Anderen verneigen, wo der sich entscheidet, seinen Partner, sein Geschlecht, seine Grundsätze zu wechseln?
Bogner denkt in den Schemata einer „wesenlosen“ Beziehungsethik.
Besonders im deutschsprachigen Raum gibt es eine Reihe von Moraltheologen, die anthropologische Vorgaben durch die Schöpfung („Männlich und weiblich erschuf er sie“…), wie durch die Natur leugnen, die Autonomie feiern und nach moralischen Ermächtigungen für abweichendes Verhalten fahnden. Sie suchen nach dem erlösenden Dürfen. Ob für sich („Ich darf!“) oder für andere („Du darfst!“), ist nicht immer klar herauszufinden. Sie sind geneigt, soziologisch (statt moralisch) zu argumentieren. Was ich tue, was eine Mehrheit tut, was gar alle tun, muss schon seine Richtigkeit haben.
Ethisch kreist alles um die „Beziehung“. Der Oberbegriff „Beziehung“ ist der Regenschirm für alles. Er hat die nötige Weite für den eigenen safe space, und man kann darunter das ganze plurale Spektrum von sexuellen Verwirklichungsformen subsumieren. Per definitionem sind sie ethisch weitgehend neutral. „Beziehungsethik“ besteht auf „Liebe“ und schaut in schöner Monotonie darauf, dass man bei der Liebe auf die Liebe achtet. Kein zwingendes Geschäft! Normativität steigt ab in Selbstberuhigung und pastorale Beratung.
Christliche Theologen dieser Couleur sind in der permanenten Versuchung, alle ethischen Anforderungen des Evangeliums in „Hauptsache Liebe“ aufgehen zu lassen und sie durch Liebe zu überzuckern oder unsichtbar zu machen. Von außen kommende moralische Klassifizierungen und Werturteile verbietet sich dieses Denkmodell. Sie sind böse, wo sonst kein menschliches Handeln mehr „böse“ genannt werden darf. Nicht einmal Jesus darf dem freien Subjekt in sein Leben dreinreden. Deshalb „ermutigt“ der neue Jesus die Zöllner und Sünder. Er versteht und gibt Zuspruch. Und die Kirche „segnet“ (ab.) Das höchste Gut, die Selbstbestimmung, in Frage zu stellen, – das ist die letzte Sünde in der neuen Welt der unlimitierten Freiheiten.
Die Diskussion um den „heterosexuellen Normalfall“ zeige, wie unterschiedlich man Normen auslegen und wie sehr das zu gesellschaftlichen Konflikten führen könne.
In der Pandemie der „Vielfalt“ gibt es eine gewisse Abschätzigkeit für den heterosexuellen „Normalfall“, – als sei dies ein abseitiger Geschmack. Solange wir freilich unsere Kinder (noch) nicht in der Retorte züchten, ist die vielgeschmähte „Heteronormativität“ der Normalfall für alle Menschen. Damit die Menschheit nicht ausstirbt, haben sämtliche Menschen einen identifizierbaren leiblichen Vater und eine leibliche Mutter, – selbst in Fällen, in denen man sich eine Leihmutter kauft. Dass der telos (philos. für „Ziel, Zielgerichtetheit“) von Sexualität immer noch die Fruchtbarkeit und nicht der Spaß ist, wird leicht vergessen in Zeiten, in denen Frauen zu ihrer fuckability chemische oder mechanische Dauersterilisierung abverlangt wird.
Böse, böse: die normierende Kirche
Die Regulierung von Sexualität, so Bogner, sei „immer wieder ein Mittel zur Machtausübung“ gewesen. Religiöse und politische Akteure hätten sexuelle Normen gesetzt und Abweichungen sanktioniert, um soziale Ordnung aufrecht zu erhalten und die Kontrolle über die Untergebenen nicht zu verlieren. Über die Rolle von Sexualität und Begehren nachzudenken … führe auch hinein „in das Verständnis gesellschaftlicher Machtstrukturen und sozialer Dynamiken. Und in die zentralen Inhalte des christlichen Glaubens samt seiner langen Konfliktgeschichte.“
Weiter geht es im sanften Hinübergleiten in andere Welten. Mittlerweile befinden wir uns irgendwo zwischen Karl-Heinz Deschner („Kriminalgeschichte des Christentums“), Eugen Drewermann (Kleriker“) und Michel Foucault (Der Gebrauch der Lüste“): Für Letzteren gibt es keine moralischen Wahrheiten, nur „diskursive Techniken der Produktion von Wahrheit“, wobei er jedes Individuum dazu ermutigt, in die Rebellion der je eigenen Wahrheit gegen die Macht (vor allem der katholischen Kirche) einzutreten. In extenso beschreibt Foucault das anhand des Beichtsakramentes. Dass mit ihm auch Schindluder getrieben wurde, steht auf einem anderen Blatt. Die Sünde wandert vom Sünder zur normierenden Institution, gegen die zu rebellieren Tugend ist.
Bogner nimmt auf den hl. Augustinus Bezug, in dessen Ehegüterlehre die Liebe zwischen den Partnern noch gar keine Rolle gespielt habe, und dem als Fernwirkung zuzuschreiben sei, „dass Homosexualität in vielen christlichen Kirchen bis heute als Sünde verurteilt wird.“
Und immer wieder – seit Herbert Haag und Uta Ranke-Heinemann – wird der böse Augustinus exhumiert, der angeblich von der ehelichen Liebe nicht positiv gesprochen und die Lust verdammt habe. Ja, er behandelte das lustvolle Begehren als Hors d’œuvre der Fortpflanzung und hatte Zeit seines Lebens mit Versuchungen zu kämpfen. Wahr ist aber auch, dass Augustinus die Ehe als etwas in sich Gutes beschrieb (und zwar nicht nur im Vergleich zu Standardverhaltensweisen seiner und unserer Zeit, nämlich zu Ehebruch, Prostitution und Inzest); in ihr könne es als besonderes Zeichen auch Enthaltsamkeit geben, worin der andere Mensch nicht allein aus sexuellem Verlangen heraus geliebt und geehrt wird, sondern um seiner selbst willen. Was die „böse Lust“ – die sogenannte Konkupiszenz – betrifft, so ist die Unterscheidung zwischen dem guten Begehren, ohne das Männer und Frauen nicht zusammenfänden und die Welt ohne Kinder bliebe, und destruktiven Triebwünschen zeitlos. „Kultur“, sagt Freud, „ist Triebverzicht.“ Hier hat Augustinus Kant und die Verdinglichung des Anderen als Sexualobjekt vorweggenommen. Wie viele moderne Beziehungsgeschichten sind nicht verbrauchende Relationen! Tatsächlich hat Augustinus (wie die gesamte theologische Tradition bis ins 20. Jh.) Homosexualität als „nicht naturgemäß“ abgelehnt, was im übrigen nur eine Wiederholung von Röm 1,27 ist. Mit Richard B. Hays (The Moral Vision of the New Testament) spricht man heute besser von einem Ausdruck der Entfremdung gegenüber Gottes ursprünglichem Schöpfungsplan.
Götter wie Harvey Weinstein
Menschen, sagt Bogner, sind „Wesen, denen eine Dynamik der Anziehung innewohnt. Sie können einander begehren. Sich hingezogen fühlen, Nähe suchen und genießen, miteinander verschmelzen und eins werden wollen …“ diese Kraft variiere in der Richtung, „in die sie uns ausrichtet.“
Klingt schicksalshaft. Mag teilweise auch so sein. Was ist, wenn sie uns auf mehr als ein Sexualobjekt ausrichtet? Zur relativen Einordnung der (hier in gediegenem Pastoralton vorgetragenen) sexualoptimistischen Einschätzungen („… Anziehung innewohnt“) empfehle ich die materialreiche Untersuchung des Religionshistorikers Gerhard J. Bellinger „Im Himmel wie auf Erden – Sexualität in den Religionen der Welt“, ersatzweise das Gesamtwerk von Sigmund Freud. Man kann auch schneller verstehen, dass der Menschheit mit der Heiligsprechung des Begehrens nicht gedient ist. Das Begehren ist der Treibstoff der Geschlechterliebe. Die ungezähmte Anarchie des Triebverlangens hat aber auch alle nur denkbaren Monstrositäten – von Sexismus über Inzest, Prostitution, Knabenschändung, Polygamie, Frauen- und Mädchenhandel, Ehebruch, Infantizid und Abtreibung, zuletzt noch Pornographie hervorgebracht, dazu eine unglaubliche Fülle von legitimatorischen Projektionen in verluderte Götterhimmel. Fast nur im Jüdisch-Christlichen sieht Gott nicht aus wie Harvey Weinstein. Wie realistisch dachte doch das Tridentinische Konzil, wo es von der Konkupiszenz heißt, sie mache zur Sünde geneigt (ad peccatum inclinat) – also Vorsicht, Freunde, mit der Diversität eurer Sehnsüchte! – aber sie sei deshalb selbst noch keine Sünde.
Bogner wird vorsichtig. Es könne sein, „dass wir es vorziehen, dieser Kraft keine aktive Rolle in unserem Handeln und Empfinden einzuräumen.“
Na hoffentlich!
Bogner nähert sich dem Phänomen Sex von der Kommunikation her. Den Menschen sei eine Sprache jenseits der Worte gegeben: der körperliche Ausdruck, dem ein vielfältiges Vokabular zur Verfügung stehe, mit dem man variantenreich sprechen könne: „Mal leise und stammelnd, mal laut und ungestüm, bittend oder fordernd.“
Natürlich ist Sex auch Kommunikation, – von der billigen Anmache bis zum Ausdruck der vollkommenen Hingabe in der ehelichen Liebe. Sex ist die Körpersprache der Liebe; darauf besteht auch die „Theologie des Leibes“. Sie empfiehlt körpersprachliche Authentizität und entwickelt die nötige Sensibilität für körpersprachliche Lügen: die falschen Küsse, suggestiven Vereinnahmungen (Mt 5,28), doppelbödigen Worte. Der Körper lügt, wenn man jemand verführt, für seine Zwecke gebraucht, ihn sich im schönen Schein zurichtet. Der amerikanische Psychologe Paul Ekman hat genauer über die körpersprachlichen „Mikroausdrücke“ der Lüge nachgedacht, wobei er sechs Momente beschrieben hat: „Es ist eine bewusste Entscheidung. Der Lügner hat die Absicht, dem Opfer eine falsche Information zu geben. Die Person hatte die Wahl zu lügen oder die Wahrheit zu sagen. Die Person kennt den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit. Das Opfer hat nicht darum gebeten, in die Irre geführt zu werden. Der Lügner hat nicht bekannt gegeben, dass er lügt.“ Im Grunde ersetzt das Achte Gebot („Du sollst nicht lügen“) das Sechste Gebot.
Körpersprache oder: Tränen lügen nicht
Es folgt ein langer Text über sexuelle Sprachkompetenz, mit der es gelinge „die Signale des Gegenübers zu verstehen und in mein eigenes Handeln einzubeziehen.“ Bogner versteht Sex als ein Spiel (Buch, S. 165), das von der Hoffnung lebe, „jemandem wirklich zu begegnen, diesen anderen Menschen zu erfahren, im umfassenden Sinn zu berühren, von ihr oder von ihm überrascht zu werden.“
Klingt ein bisschen nach Erika Berger (+ 2016) und „Eine Chance für die Liebe.“
Das Erotische bestehe darin, „dass dieses Sich-Aussetzen ein Risiko birgt. Es steht viel auf dem Spiel.“
Eine Ohrfeige, eine Anzeige, ein Kind …?
„Sex“, sagt Bogner, sei „Versprechen und Verheißung“. Wie sich das im Bett ereignen könne, dekliniert er durch in „Akten des Fragens, der Zeichen, des Erkundens … ihn zu fassen, ohne ihn festzuhalten.“ Begehren, aber nicht Besitzen! Keine Technik! Bis das „Wunderbare eintritt“ …, das Bogner in ein Zitat von Katherine Angel einpackt: „… gelingende Balance von Körper und Geist, in der Vertrautheit und Fremdheit, Ruhe und Überraschung miteinander reagieren.“ Nun wird Bogner hymnisch: „Ich bin ganz bei mir und ich übersteige mich unaufhörlich selbst. … Und so möchte man versucht sein, die sexuelle Begegnung als »sakramental« zu verstehen: zeichenhafte Praxis eines Lebens, das erst im – beglückenden, verwickelten, oft genug komplizierten – Miteinander zu sich kommt, im Sex vorweggenommen als ein Versprechen auf so viel mehr.“ Hier ist für Bogner die Nahtstelle zwischen „Sexualität und Religion“. Sex als Transzendenz, als heiliges Zeichen? Sex als Sakrament?
Worauf zielt dieser salbungsvolle Beratungskitsch? Sex in den Ordnungen der Liebe ist ein Geschenk, eine wonnevolle Begleiterscheinung der Hingabe. Sex um seiner selbst willen gesucht, führt in den nächsten Tantra-Kurs.
Religion und Sex als Spiegel meiner selbst
Was aber haben Sex und Religion miteinander zu tun? In beidem, so Bogner „bin ich damit konfrontiert, dass es ein Gegenüber gibt, das mir ein Spiegel meiner selbst ist, ob ich es will oder nicht.“
Der Andere und Gott tauchen am Horizont auf, als ein „Gegenüber“, das es immerhin gibt, als „Spiegel meiner selbst“. O-Ton Ovid: „Narcissus ungeduldig: ´Was flieht ihr vor mir?´ Echo: ´Flieht ihr vor mir?´ Narcissus verzweifelt: ´Vereinen wir uns!´ ´Vereinen wir uns!´ antwortete Echo, und mit diesen Worten trat sie aus dem Wald hervor und schlang ihre Arme Narcissus um den Hals.“ Daniel Bogner – Narcissus in theologicis? Die Selbstbestätigung als letzte Quelle von Religion und Sex?
Und noch etwas haben – Bogner zufolge – Religion und Sex gemeinsam: „Sie werden beeinflusst und geformt von einer Kultur, einer Mentalität, von vererbten Glaubenssätzen und Machtverhältnissen.“
Die anfordernde Stimme Gottes verschwindet im Nebel von Mentalitäten, Glaubenssätzen, Machtverhältnissen. Also können wir dran schrauben! Basteln wir den Sex und die Religion, die zu uns passt und uns in dem bestätigt, was wir sind.
Bogner unterstellt der Kirche, sie sei besessen von der Annahme, „Sex sei im Kern etwas Gefährliches und Korrumpierendes.“ Deshalb sei es ihr um „detailgetreue Beschreibung der Situationen, in denen Sex als akzeptabel gelten durfte“ gegangen.
Das war und ist korrekt, entspricht ganz dem Neuen Testament, darin insbesondere der Bergpredigt. Dass Sex risikolos, universal verfügbar, sündenfrei und ungefährlich sei, ist eine nostalgisch anmutende Standardbehauptung von Leuten wie Wilhelm Reich (+1957). Nach den Missbrauchsskandalen und #MeToo wird sie heute nur noch von lustaffinen katholischen Theologen vertreten, die den hl. Augustinus falsch verstanden haben: “Ach, dass ich dich so spät erkannte, du hochgelobte Schönheit, du…“ (Angelus Silesius nach Conf. 10,27.34)
Das Format einer »katholischen Sexualmoral« hält Bogner für überholt. Da gehe es nur um „Daumen rauf – Daumen runter“ …
Zweifelsfrei hätte die Kirche ihre sittliche Verpflichtung zur Weisung nach den Geboten Gottes besser tugendethisch begründet und damit Menschen geholfen, einen Weg zum Guten und zu Gott zu finden, statt mit kasuistischen Beschreibungen des Verbotenen und Erlaubten. Seltsamerweise verbleiben die Vertreter einer „neuen Sexualmoral“ – wie Bogner eben einer ist – in den Denkmustern genau dieser antiquierten Verbotsmoral; nur möchte man – „Daumen rauf“ – die Grenzen des Erlaubten gönnerhaft erweitern. Übrigens ohne Ausweis einer echten Legitimation.
Die „katholische Sexualmoral“ werde schließlich auch von den allermeisten Katholikinnen und Katholiken nicht befolgt, was man an der „Wirkungsgeschichte der Enzyklika »Humanae vitae«“ unschwer sehen könne.
Quantitative Akzeptanz des moralisch Gebotenen als Kriterium seiner Geltung? Weil alle lügen, ist Lügen erlaubt? By the way: Kein päpstliches Dokument wird derzeit in seiner prophetischen Qualität intensiver wiederentdeckt als „Humanae vitae“. Seinerzeit verhöhnte die Kirche Paul VI. Nur der kluge Kopf der Frankfurter Schule, der Sozialphilosoph Max Horkheimer, sprang ihm bei. Ein Blick in die außerdeutsche Rezeption wäre hilfreich.
Die Liebe – ein Bombengeschäft?
Da der Mensch frei ist, müsse auch im Sex „vieles neu ausgehandelt werden“.
Nein. Ausgehandelt wird in der käuflichen Liebe. Nicht in der Moral.
„Jenseits von Gut und Böse“? Wie vordem Friedrich Nietzsche sucht Bogner nach einer Moral jenseits überkommener Normen, Werte und religiös kontaminierten Vorstellungen. „Aber nach welchen Kriterien?“, fragt sich Bogner, schwimmend im Orbit universalen Begehrens: „Was mache ich zum Beispiel, wenn ich mich zu mehreren Personen sexuell hingezogen fühle oder zu mehr als einem Geschlecht? Was, wenn mein Partner, meine Partnerin die »Sprache« meiner Sexualität nicht mehr versteht oder nicht mehr schön findet? Was, wenn eine neue Begegnung so faszinierend und verheißungsvoll ist, dass sie mich – vielleicht zum ersten Mal – sexuell im Tiefsten berührt? Wenn ich das Gefühl habe, ich muss ihr nachgehen, um mir selbst treu zu bleiben? Wie gehe ich mit den Verletzungen um, die das möglicherweise für den anderen bedeutet?“
Sehr interessante Fragen, die auf der falschen Annahme basiert, sexuelles Handeln müsse sich vor allem an meinem Begehren orientieren. Was, wenn mir der Sinn nach Kindern stünde? Oder nach vielen Personen gleichzeitig? Oder nach jemand, der sich freuen würde, von mir gequält zu werden? Papst Franziskus: „Alle Sünden entstehen aus einem sündhaften Begehren. Alle. Dort beginnt das Herz sich zu rühren, man gerät in jene Welle hinein und endet mit einer Übertretung.“ Wenn dem so ist, kommt die Kirche nicht umhin, gewisse Unterscheidungen zu treffen oder sich vor dem Richterstuhl Gottes wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten zu müssen. Dietrich Bonhoeffer: „Es gibt gutes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche.“
Noch ganz beim Gesetz der Begierde, rührt sich in Bogner das Gewissen: „Und was bedeutet das für die Beziehung, die ich bislang gelebt habe, aus der möglicherweise Kinder hervorgegangen sind? Diese haben in aller Regel ein vitales Interesse an einer stabilen Beziehung von Vater und Mutter, selbst wenn sich diese auseinandergelebt haben und sich sexuell wie emotional nichts mehr zu sagen haben.“ Lust gegen Verantwortung. Was ist stärker? Bogner: „Solche Fragen haben Sprengkraft, denn sie berühren das, was Menschen im Innersten ausmacht.“
Wenn das Innerste menschlicher Identität „Begehren“ ist, kann man sich die Sprengkraft besonders gut ausmalen. Dann geht Schnitzlers „Reigen“ über die Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit der Liebe. Taler, Taler, du musst wandern! Und am Ende folgt man dann doch der „unerbittlichen Mechanik des Beischlafs“ (Jenny Hoch)?
Bogner spricht von „Normen und Regeln … die sich Religion und Gesellschaft“ gegeben hätten, um die Welten ihrer Intimität zu ordnen. Bogner fragt sich: „Wie kann ich solch existenzielle Krisen deuten – als sexueller und als religiöser Mensch?“
„Normen“, die keine anderen als gesellschaftliche oder religiöse Wurzeln haben, sind Vorurteile, Vereinbarungen, Sportregeln oder Satzungen, aber keine Normen. Echte Normen werden entdeckt, nicht beschlossen.
Bogner zitiert die klassische Lösung „katholischer Provenienz“. Man müsse „eben der Versuchung widerstehen und auf dem Pfad der Tugend bleiben.“ Das, findet Bogner, sei überholt: „Eine solche Antwort reicht heute nicht mehr aus.“
Wieso nicht? Die Antwort ist weniger „katholischer“, als biblischer Provenienz: „Seid nüchtern und wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann.“ (1 Petr 5,8) Wir nähern uns langsam dem libertären Freiheitsbegriff, wie ihn Magnus Striet und andere vortragen. Da geht es um eine Freiheit, die sich erst frei fühlt, wenn sie ganz und gar autonom, also letztlich auch gottfrei ist. In Kreisen dieser gott-losen Ethik redet man gerne vom Menschen als einem „zu verantwortlicher Lebensgestaltung fähige(n) und dazu berufene(n) Wesen“. Es ist dieser Horizont, in dem der „heilige Bund der Ehe“ zur „abstrakten Norm“ verkommt. In der gleichen Abstraktion verblasst auch Gott als das läppische Unerhebliche im Prozess der freien Selbstentfaltung des Subjekts.
Getrieben und irgendwie verantwortlich
Bogner muss begründen, inwiefern der Mensch ein Wesen ist, das sich selbst norma normans non normata ist. Er macht das so: Erstens sei der Mensch zu „verantwortlicher Lebensgestaltung“ fähig und dazu berufen. „Natürlich sind wir nicht einfach Getriebene unserer Bedürfnisse und Gefühle, wir haben auch eine Verantwortung.“
Da machen wir einen Haken dran. Nicht abhaken können wir die Frage, gegenüber wem der Mensch verantwortlich ist. Allein sich selbst gegenüber? Das hat noch nie funktioniert. Also doch dem „Echo der Stimme Gottes“, die wir im Gewissen vernehmen? Gewissen hat nur Sinn, wenn da etwas spricht, was ich mir nicht selbst zuflüstere. John Henry Newman wies jede Form solipsistischer Autonomie zurück: „Ich bedarf gar sehr eines Monitors, der mich führt, und ich hoffe zuversichtlich, dass mir mein Gewissen, erleuchtet von der Bibel und geführt vom Heiligen Geist, ein treuer und sorgsamer Hüter der wahren religiösen Grundsätze sei.“
Zweitens, sagt Bogner, sei der Mensch „eine Einheit aus Körper, Seele und Geist“, was bedeute, „dass Menschen nicht einfach über den Leisten einer abstrakten Norm geschlagen werden können.“
Diese Logik erschließt sich mir nicht. Normen sind immer überindividuell. Selbst eine Stabhochspringerin, die sich 5,07 m als Norm in den Trainingsplan schreibt, springt nicht über eine abstrakte Höhe; sie orientiert sich an den 5,06 m von Jelena Gadschijewna Issinbajewa und der Wettbewerbsordnung des IOC.
Bogner ist einmal mehr beim Sowohl-als-auch. Es müsse „situationsangemessen geurteilt werden (…), ohne damit grundsätzliche Orientierungen für überflüssig zu erklären.“
Ja, man kann auch den Sprung abbrechen, was an der Höhe der Sprunglatte nichts ändert. Aber die salvatorische Klausel („situationsangemessen“) darf natürlich nicht fehlen. Gerade sieht man, wie viel sie wert ist, wo es um den Lebensschutz und die Euthanasie geht. Die konkrete „Not“ triumphiert in allen Fällen über die scheinbar nur papierene Orientierung und die zur Abstraktion kastrierte Norm.
Nun holt Bogner zur großen Schimpfe aus. Die Kirche habe „jahrhundertelang“ (jedenfalls ante Bogner) die abstrakte Norm über „das Leben der Menschen mit ihren Erfahrungen“ gestellt. Damit habe man aber gerade die je individuelle Berufung der Menschen verfehlt. Gott schreibe doch auch auf krummen Zeilen gerade.
Hier hilft es immer auf Jesus zu schauen, der keine Berührungsscheu mit „abstrakten Normen“ hatte („Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde“, Mt 18,6), gleichzeitig aber auch höchst sensibel und mäeutisch mit der Samaritanerin am Brunnen (Joh 4) umgeht. Bei Bogner weicht Rückbindung menschlichen Handelns an das Gottgefällige dem Kotau vor jedweder menschlichen Erfahrung. Selbst für Paulus ist das „Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut.“ (Röm 7,12) Im theologischen Horizont der Bogners manifestiert sich in der „Erfahrung“ das Heilige. Ein scheinbar nur von außen kommendes Gesetz (Gottes) erscheint als zugemutete, die Freiheit beschränkende Entfremdung von der je individuellen Berufung, gar als Last, die mich vom Heiligtum meiner innersten Bestimmung abbringt. Im Kontrast die Selbsterfahrung von Paulus: „Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde.“ (Röm 7,19-20) Und Augustinus, der weiß, an welcher Stelle sich der Widerspruch auflöst: „Der Herr ist uns näher, als wir es selbst sind – interior intimo meo et superior summo meo“ (Bekenntnisse, III,6,11)
Von der Liquidation der Moraltheologie
„Eine Ethik der Liebe“ brauche unbedingt Begriffe und Bilder des Weges, des Prozesses, des Parcours.
Okay.
Dann fügt Bogner aber noch hinzu: „… nicht Kategorien der Vorgabe, der Befolgung und der Erfüllung.“
Nicht okay. „Das Gesetz des Herrn ist vollkommen“ (Ps 19,8), nicht unsere Setzungen. Der große Katechismus eröffnet seine ethischen Weisungen mit dem Passus: „´Der Weg Christi führt zum Leben´, ein gegenläufiger Weg jedoch führt ´ins Verderben´ (Mt 7, 13_14) … Es zeigt, wie wichtig sittliche Entscheidungen für unser Heil sind. ´Der Wege sind zwei: einer des Lebens und einer des Todes. Sie gehen aber weit auseinander´ (Didaché 1, 1).“
Es gehe darum, einen neuen Stil ethischer Rede zu finden, damit „Menschen in Bewegung bleiben und die für sie und ihre Situation passenden Entwicklungspfade einschlagen können.“
Bei jedem zweiten Satz von Bogner fällt auf, wie er Feststehendes liquidiert, Anforderungen relativiert und normative Vorgaben ent-normalisiert. Bogner merkt scheinbar nicht, dass er sich damit als Ethiker überflüssig macht; er organisiert den fließenden Übergang seines Berufsstandes in die nondirektive Lebenshilfe. Theologisch verabschiedet sich Moraltheologie in einen Dämmerzustand zwischen Pastoral und Dale Carnegie.
Mit dem, was Bogner dann noch „ethische Grundgrammatik“ nennt, schafft er eine Thomas-A.-Harris-Kuschelzone, in der alles sein darf. Man ist da nicht „überrascht, wenn Menschen auf ihrem Weg des Liebens stolpern und fallen. Dann tut sie alles, um es diesen Menschen möglich zu machen, wieder aufzustehen und als Liebende miteinander weiterzugehen, möglichst lange.“
Möglichst lange … Hier geht die Tür auf, für alle, die sich geschworen haben: Ich will dich lieben, achten und ehren, solange unser Vorrat an Liebe reicht.
Bogner ahnt, dass hier die Unauflöslichkeit der Ehe mit Fragezeichen versehen wird. Deshalb baut er gleich vor: Das Konzept „einer dauerhaften exklusiven Partnerschaft“ sei doch „für sehr viele Menschen attraktiv.“ Denn es schafft “ Planungssicherheit und federt Notlagen ab, es ist auch das Versprechen auf ein Erleben von Gemeinschaftlichkeit und Nähe, die für viele zu den begehrtesten Gütern überhaupt gehören.“ Deshalb tue „eine christlich inspirierte Ethik“ gut daran, Menschen zu „ermutigen, dies als Option für sich in Erwägung zu ziehen und mit aller Kraft zu versuchen.“
Wie nett.
Neue Varianten? Passt schon!
Die neue „Ethik des Liebens“ müsse freilich ihre Scheuklappen ablegen und für sich realisieren, dass 40 Prozent der Ehen wieder geschieden werden. Bogner staunt und betrachtet mit Wertschätzung, was sich so tut in der Lebenswirklichkeit heute: „Es entstehen neue, vielfältige Formen der Intimität: die »serielle Monogamie«, also die aufeinander folgende exklusive Paarbeziehung, aber auch zweckorientierte Lebensgemeinschaften, platonische Freundschaften, Kontakte über das Onlinedating, sogenannte Freundschaft-plus-Beziehungen, generationenübergreifende Wohngemeinschaften.“
Alles gut! Oder wie man in Augsburg sagt: Passt schon! In dieser schönen neuen Welt liebender Möglichkeiten nimmt sich die Ehe höchst unattraktiv aus. Wer braucht denn noch sowas! Bogners wertfreie Auflistung erinnert an die legendären Bätzing-Worte, mit der er die Anhänger einer exklusiven Auffassung des Ehesakraments zu beschwichtigen suchte: „Bitte leben Sie doch, was Ihnen wichtig ist, und das nehmen wir Ihnen nicht weg.“
Bogner weiß schon, dass viele dieser Arrangements christlich nicht im Portfolio sind; er wählt dafür die Worte: sie lägen, „jenseits der heteronormativen Paarnorm.“ Aber man müsse doch feststellen: „Sie tragen dazu bei, mit Nähe und Intimität Welten zu bauen und ein In-der-Welt-Sein zu eröffnen.“ Was immer das heißt.
Die „heteronormative Paarnorm“ findet sich im Buch Genesis. Sie ist exklusiv und eine wesentliche Vorgabe für Juden wie Christen. Sie wird überdies von Jesus in Mt 19 bestätigt. Sie ist nicht eine statistisch nachrangige Beziehungsform unter anderen Beziehungsformen, die auch ihr Schönes haben.
Bogner will das alles integrieren und schlägt vor, man könne doch an den Bundesgedanken im Alten Testament anknüpfen, schließlich wollten doch „Menschen miteinander Bande knüpfen und auf eine besondere Weise in Verbundenheit miteinander treten.“ Dies könne unter den Vorzeichen emotionaler Ekstase geschehen (Zwischenfrage: bei Freundschaft-plus?, beim One-Night-Stand?), „aber ebenso unter dem Vorzeichen von Freundschaft oder helfender Nähe.“
Die Bundesschlüsse im Alten Testament sind heilige Übereinkünfte Gottes mit Einzelnen oder mit seinem Volk. Die Heiligkeit des Ehesakraments („Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen“, Mt 19,6) resultiert a) aus dem „Bund“, d.h. aus der Übernahme der Kategorie einer von Gott kommenden höchsten Verbindlichkeit; und sie wird b) noch einmal durch Eph 5,25 gekrönt: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat.“ Darf man es abgeschmackt finden, wenn Bogner versucht, allerlei denkbare Arrangements in die Nähe von „Bund“ zu hieven?
Sex ist für Bogner normale Kommunikation – in einer „Vielfalt von Rede- und Ausdrucksweisen“, die es gelte wahrzunehmen und zu respektieren. Die Kirche müsse Menschen endlich „die Erfahrung sexueller Begegnungen … ermöglichen, die ihnen gerecht werden“.
Uff, … da knipst Bogner beim Leser aber das Kopfkino an.
Es brauche keine Verbote, nur eine „Ethik des Liebens und Begehrens, … so etwas wie minimale Anforderungen“, worunter er besonders „die Kriterien der Unversehrtheit, der Einvernehmlichkeit und der Gegenseitigkeit“ empfiehlt. Personen dürften „nicht Schaden nehmen, physischer, psychischer oder spiritueller Art.“
Das machen dann erwachsene Menschen schon unter sich aus. Dazu brauchen sie den frommen Sermon nicht.
Die zynische Konstellation
Fazit nach Interview und Lektüre des Buches: Daniel Bogners „neue Sexualmoral“ ist der untaugliche Versuch, die „Lebenswirklichkeit heute“, der er eine normative Geltung zumisst, mit dem Christentum zu versöhnen. Bogner kann sich auf kein einziges kirchliches Dokument berufen, an dem er nur entfernt anknüpfen könnte. Was normativ von der Schrift her gilt, besichtigt er wie von außen. Statt da anzusetzen, wo sich Gott als ein Gott der Liebe offenbart, orientiert sich Bogner an Mainstream-Verhaltensweisen und scannt die Schrift auf das, was da noch zur freien Selbstbestimmung heutiger Menschen passt. Im Effekt bleibt nicht viel mehr, als dass Gott „Liebe“ ist und Jesus mit Zöllnern und Sündern gegessen hat. Seine aus Positiv-Denken-Elaboraten, Gendertext und Sexualratgebern zusammengetragene permissive Lebenshilfe schmückt Bogner mit eklektischen Bibelzitaten. Eine einzige seriöse Monographie (derzeit das Maß der Dinge: Becker, Ehe, Familie und Agamie, Tübingen 2023) hätte ihn über die anspruchsvollen neutestamentlichen Begründungszusammenhänge informiert, die von der Kirche wie durch ein Wunder gegen jeden Trend bis heute durchgehalten wurden.
Bogners „neue Sexualmoral“ ist der Versuch, Anschluss zu gewinnen an ein in sich geschlossenes lebensweltliches Konzept, das durch drei Faktoren bestimmt wird: Der Treiber ist Lust/Begehren, die Legitimation ist selbstbestimmte Freiheit und der Ermöglichungsgrund ist die technische (mechanisch/chemische) Ausschaltung des „Fruchtbarkeitsrisikos“. Dieses Konzept schmiegt sich nahtlos einer Welt technoiden Denkens an, das keine spezifisch menschliche, sittliche oder religiöse Haltung voraussetzt. Menschen wenden das Machen, Konstruieren und Gebrauchen zuletzt auch auf das lebendige Fleisch von sich und anderen an und behandeln sich nach Art von Masse und Gerät. Eine ethische „Haltung“ wird erst da gefordert, wo es durch Technikversagen zur menschlichen Tragödie, dem ungeplanten Kind, kommt. Die Auslöschung des Kindes muss möglich sein, damit, was ich die „zynische Konstellation“ nenne – das dreifach falsche Zuspiel von Lust, Freiheit und Technik – funktioniert, als sei nichts gewesen.
An diesem System der Lüge kann sich eine „katholische Sexualmoral“ niemals beteiligen.
Bernhard Meuser
Jahrgang 1953, ist Theologe, Publizist und renommierter Autor zahlreicher Bestseller (u.a. „Christ sein für Einsteiger“, „Beten, eine Sehnsucht“, „Sternstunden“). Er war Initiator und Mitautor des 2011 erschienenen Jugendkatechismus „Youcat“. In seinem Buch „Freie Liebe – Über neue Sexualmoral“ (Fontis Verlag 2020), formuliert er Ecksteine für eine wirklich erneuerte Sexualmoral.
Bildquelle: Gustav Klimt, Der Kuss, Wien 1908, Ausschnitt, bei Adobe Stock