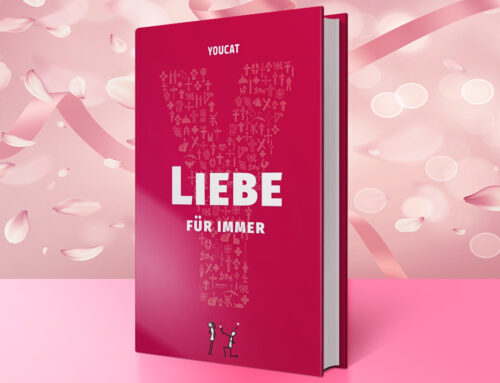Der Anfang vom Ende
Auslegung des Evangeliums vom 33. Sonntag im Jahreskreis C, Lk 21, 5-19
Der Tempel wird zerstört werden. Jesus sagt die Zerstörung an. Die Phase bis dahin ist wie ein Vorspiel für das Kommende. Jesus sagt den Seinen, wie sie sich verhalten sollen. „Endzeit“ ist real, seit Jesus gestorben und auferstanden ist. Aber Hysterie ist nicht angesagt. Statt dessen: Klare Ausrichtung, Vertrauen und Geduld. Sie gewinnen das Leben.
Wann beginnt die Endzeit?
Der christliche Glaube kennt keine einfache, linear voranschreitende Fortschrittserzählung: Es wird nicht einfach immer besser, seit Jesus uns erlöst hat. Eher wird die Situation dramatischer. Seitdem Gott Mensch wurde, seitdem Jesus gestorben, auferstanden und zur Rechten des Vaters erhöht wurde, eingesetzt als Kyrios, hat Geschichte und Kosmos ihr Ziel erreicht. Denn in seiner Verklärung durch den Heiligen Geist ist die Königsherrschaft des Vaters im Fleisch des Sohnes zur Vollendung gelangt. Allerdings ist diese Wirklichkeit noch verhüllt, damit menschliche Freiheit angesichts dieser Wirklichkeit noch die Möglichkeit der Antwort behält. Wäre sie schon offenbar, wäre die Geschichte der Freiheit beendet, weil ihr Horizont völlig erfüllt wäre und deshalb keine Entscheidung mehr möglich. Was in der Sichtbarkeit von Geschichte und Kosmos also jetzt noch abläuft, ist das Drama der menschlichen Antwort auf dieses göttliche Geschehen – bewusst oder unbewusst. Denn jedes menschliche Dasein ist durch den Tod und die Auferstehung Jesu bestimmt – ob es davon weiß oder nicht.
Menschliche Freiheit ist so in ihre endgültige Möglichkeit gelangt: Sie muss vor der letzten Bestimmung der Wirklichkeit durch Gott „Ja“ oder „Nein“ sagen. Dadurch bekommt sie ihre letzte Radikalität: Im „Ja“ von Glaube, Liebe und Hoffnung erlangt sie eine Güte über alles natürlich Gute hinaus, in der Verstockung des Herzens öffnet sich der Abgrund einer Bosheit, die die nur natürlichen Grenzen sprengt. Das Gute wird besser, das Böse noch böser. „Corruptio optimi pessima“ sagten die Römer: das Verderben des Besten ist das Allerschlimmste. Die Gnade ist in Christus siegreich und ringt um das „Ja“ der Zustimmung. Aber sie vergewaltigt nicht. Deshalb fragt Jesus sich, ob er als wiederkommender Menschensohn noch Glauben finden wird, und er sagt ein Enddrama an, das so schlimm wird, dass niemand es aushielte, würde es der Vater nicht verkürzen. Aber es gilt auch: Seit Jesus gestorben und auferstanden ist, ist der endgültige Sieg schon errungen und er wird sich durch alle Dramen und Untergänge hindurch durchsetzen. Jesus ist Sieger – und mit seinem Sieg hat die Endzeit begonnen.
Anfang vom Ende: Der Tempel und sein Untergang
So müssen wir uns gar nicht darüber streiten, ob die Endzeit schon da ist. Selbstverständlich leben wir darin! Seit Jesu Auferstehung hat die Vollendung begonnen, denn Auferstehung der Toten ist das endzeitliche Ereignis schlechthin – und der Widerstand gegen diese Vollendung bäumt sich auf. Bestenfalls kann man fragen: Wo stehen wir gerade in diesem Drama?
Ob diese Frage wohl sinnvoll beantwortet werden kann? Denn auch die Zeichen der Endzeit bestimmen alle Zeit seit Jesu Auferstehung – mal dichter, mal weniger dicht. So meint es zumindest der große syrische Kirchenvater Ephräm. Und lokal haben Menschen auch immer wieder Untergänge ihrer Welt erlebt. Zuletzt wird um jeden von uns die Welt versinken und uns hoffentlich dann das Licht des Antlitzes Christi aufgehen. Das alles sind aber nur die Vorspiele der Verwandlung und Vollendung des ganzen Kosmos und der ganzen Geschichte, die kommen wird. Sicher! Denn Jesus ist auferstanden!
Das erste Zeichen aber, dass das Ende seinen Anfang genommen hat, ist der Untergang des Tempels von Jerusalem. Nach dem Untergang des ersten, des salomonischen Tempels 586 v. Chr. hatten die von Kyros, dem Perserkönig, heimgeschickten Judäer schließlich einen recht bescheidenen Neubau unter Mühen hinbekommen (515 v. Chr.). Dennoch: Nachdem das davidische Königtum nicht mehr restauriert wurde, waren Tempel und Tora die entscheidenden Träger jüdischer Identität in einer kleinen Provinz im persischen Großreich, dann unter den Nachfolgern Alexanders, unter den Hasmonäern und schließlich als Randprovinz des Imperiums der Römer. Erst jetzt, in der Zeit nach dem babylonischen Exil, kann man vom Judentum sprechen – und dieses Judentum, das sich in seiner religiös-kulturellen Identität ohne politische Selbstständigkeit in so bewundernswerter Weise behauptet hat, war versammelt um Tempel und Tora.
Deshalb war es ein politischer Schachzug von großer Klugheit, als der Halbjude Herodes (37-4 v. Chr.), um seine Herrschaft zu festigen, den baufällig gewordenen Tempel um 20 v. Chr. zu einem Weltwunder umbaute. Das bedeutete für ihn selbst, aber eben auch für seine Untertanen, diesem vielfach gedemütigten Volk, Prestige und reichsweite Bewunderung. Denn das gigantische Projekt wurde durchaus im ganzen Imperium wahrgenommen. Wie gesagt: Ein Weltwunder! Und überdies für viele Menschen Arbeit für viele Jahrzehnte. Wurde der Kernbereich sehr schnell errichtet, dauerte der Gesamtausbau des riesigen Areals bis kurz vor dem Ausbruch des jüdischen Kriegs 66 n. Chr., der dann schon 70 n. Chr. zu seiner Zerstörung führte.
Diese Zerstörung aber kündigt Jesus prophetisch in unserem Sonntagsevangelium an. Man hat viel darüber diskutiert, ob wohl die Evangelisten erst nach dem Ereignis der Tempelzerstörung schreiben konnten, weil sie sich ja auf diese Zerstörung beziehen, was dann bedeutet, dass man Jesus die Ansage des Ereignisses nicht zutraut. Aber wer so denkt, redet natürlich nicht als Historiker, sondern macht weltanschauliche Voraussetzungen – es gibt keine echte Prophetie und auch Jesus war dazu nicht fähig -, die keineswegs evident, nicht einmal plausibel sind. Das ist hier nicht zu diskutieren, nur eines sei vermerkt: Noch völlig jenseits der Frage, ob Jesus das Ereignis in echter Prophetie angesagt hat, konnte ein politischer Kopf die politische Katastrophe eines möglichen Aufstands gegen die Besetzungsmacht und deshalb auch die Möglichkeit einer Zerstörung Jerusalems und des Tempels voraussehen.
Dieser Tempel ist also in der Zeit Jesu zutiefst Träger religiöser Identität und gleichzeitig nationalen Stolzes. Das drückt sich im Eingangsvers unseres Evangeliums aus: Der prachtvolle herodianische Neubau löst bei einigen eine Mischung aus religiöser und ästhetischer Bewunderung aus. Es muss einen fürchterlichen Schock und fürchterliches Erschrecken auslösen, wenn Jesus ankündigt, dass da Tage kommen, an denen hier kein Stein auf dem anderen bleibt. Für die Identität dieser Menschen ist es ein religiös-nationaler Weltuntergang, der hier angekündigt wird. Mit dem Tempel geht die religiöse und die nationale Identität in Trümmer. In der weiteren Perspektive Jesu ist das allerdings nur der Anfang vom Ende.
Verhaltensanweisungen für die Endzeit
Die, die Jesus zugehört haben, sind also zutiefst erschrocken. Und sie fragen nach der Zeit und den Zeichen des angekündigten Geschehens. Wann wird es sein? An welchen Signalen können wir es erkennen?
Jesus beantwortet diese Fragen nicht direkt. Er sieht eher den Untergang des Tempels als Anfang einer langen Fluchtlinie bis zur Wiederkunft des Menschensohns. In unserem Evangelium geht sein Blick tatsächlich auch schon perspektivisch über dieses Ereignis hinaus, aber hauptsächlich schaut er tatsächlich auf die Phase bis zur Zerstörung Jerusalems. Denn unmittelbar nach unserem Evangelium kommt er direkt auf seine Verwüstung zu sprechen. Das ist manchmal nicht leicht zu unterscheiden, weil Weite und Nähe wie perspektivisch ineinander geschoben wirken.
Aber, und das ist zum Verständnis und zur Fruchtbarkeit für unser Evangelium entscheidend: Die Frage nach Zeichen und Zeiten tritt in der Antwort Jesu zurück, zugunsten von Haltungen, wie wir auf die grundsätzlichen Herausforderungen, die Jesus nennt, richtig reagieren. Diese Herausforderungen haben zwar auch grundsätzlich endzeitlichen Zeichencharakter, aber sie beziehen sich nicht allein auf die Phase bis zum Untergang des Tempels, sondern weisen darüber hinaus, so dass diese Phase zum Modell wird, das zeigt, was wir endzeitlich zu bewältigen haben. Darin liegt die Aktualität unseres Evangeliums.
Was sind das nun für Herausforderungen? Drei kann man nennen:
- Falsche Messiasse und falsche messianische Zeitansagen. Immer schon konnte die Sphäre der Politik götzenhaft aufgeladen werden. Aber seitdem Jesus gekommen ist, geschieht das vor allem durch Pseudo-Messiasse und durch falsche Verheißungen einer messianischen Zeit. Man darf fragen, ob der Wokismus nicht genau ein solcher Pseudomessianismus ist. Denn er verheißt eine messianische Zeit vollendeter Gerechtigkeit – aber hinter ihm lauert die gefährliche Fratze eines neuen, brutalen Totalitarismus.
- All die Katastrophen, die, wenn sie Menschen treffen, Leben und Lebensordnungen bedrohen. Die, wenn sie gehäuft und kombiniert auftauchen, die Stabilität aller Lebensverhältnisse zerstören, die Menschen brauchen, um gut und sicher leben zu können. Kriege, bis zum allgemeinen Weltbürgerkrieg, Seuchen, Hungersnöte, Naturkatastrophen. Miteinander kombiniert werden sie zu Endzeitszenarien; Schrecknisse, die kollektive Ängste, ja Panik auslösen. Kosmische Veränderungen, als Zeichen gelesen, können die letzte Sicherheit nehmen. Ist das nur subjektiv? Nur Ausdruck kollektiver, aber letztlich irrationaler, nicht in der Wirklichkeit begründeter Ängste? Das bleibt hier schwebend – Jesus liefert eben keinen eindeutig bestimmbaren Katalog von Vorzeichen. Er verweist vielmehr, wie gleich deutlich wird, auf die Haltungen der Bewältigung dieser Herausforderungen. Dennoch sind diese Szenarien für ihn real. Und sie kennen so etwas wie „endzeitliche“ Verdichtung. Sie haben auch metaphorischen, bildlichen Charakter. Aber gelesen werden wollen sie in einem metaphorischen Realismus, der in den Bildern mehr, nicht weniger Wirklichkeit zeigt. Denn jedenfalls: Alles hat Gott in der Hand. Und der Durchbruch der Wirklichkeit Gottes bedeutet auch die höchst reale Erschütterung aller kosmischen und gesellschaftlichen Realität.
- Schließlich und ganz einfach, wenn auch nicht einfach zu ertragen: Hass, Verfolgung, Martyrium. Erinnern wir uns, was wir am Anfang gesagt haben: Die Freiheit kommt in ihre letzte Möglichkeit. Lehnt sie die Wirklichkeit des in Jesus gekommenen Gottes ab, kennt ihr Vernichtungswille notwendig keine Grenzen.
Zu welchen Haltungen aber rät uns Jesus, um diese endzeitlichen Herausforderungen zu bewältigen? Versuchen wir die Stichworte zu identifizieren, aber zunächst so etwas wie eine Grundhaltung. Negativ ausgedrückt kann man sagen: Sich niemals in endzeitliche Hysterie und Panik versetzen lassen. Jesus ist Sieger! Das steht längst fest – und er lässt die Seinen nicht im Stich, selbst wenn sie durch Not und Tod hindurch müssen. Deshalb: Gelassenheit, Gelassenheit und nochmals Gelassenheit. In allen Kämpfen, die tatsächlich gekämpft werden müssen und allen Schlachten, die geschlagen werden müssen. Konkret: Sich nicht irreführen lassen durch pseudomessianische Verführung. Wer mir etwas verkaufen will, das nicht in klarer Identität steht mit dem Glauben des historischen Christentums und deshalb, für den Katholiken mit dem Glauben seiner Kirche, der lügt. Dann, in aller Erschütterung, wissen: Gott ist Schöpfer, Erlöser, Heiligmacher. Er ist größer als alle Erschütterungen. In allen Untergängen wird er aufgehen. Weiter: In allen Situationen von Verfolgung und Hass einfach geistlich leben. In der Freude am Herrn liegt unsere Stärke. Nicht versuchen, alles vorwegzunehmen. Lieber in die geistliche Tiefe gehen und sich dort festmachen. Wir können nicht alles vorwegnehmen. In der entscheidenden Situation, in der unser Zeugnis gefordert wird, da wird Gott führen. Alles in allem: Standfeste, in Gott verankerte Geduld. Denn sie gewinnt das Leben.
Dr. theol. Martin Brüske
Martin Brüske, Dr. theol., geb. 1964 im Rheinland, Studium der Theologie und Philosophie in Bonn, Jerusalem und München. Lange Lehrtätigkeit in Dogmatik und theologischer Propädeutik in Freiburg / Schweiz. Unterrichtet jetzt Ethik am TDS Aarau. Martin Brüske ist Mitherausgeber des Buches “Urworte des Evangeliums”.