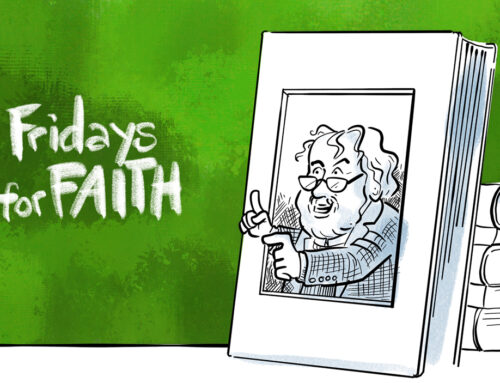Das Fest der Darstellung des Herrn im Tempel zeigt dem Volk Israel und uns liturgisch 40 Tage später, was im Stall von Bethlehem geschehen ist: Gott ist Mensch geworden. Das Maß des Menschlichen gewinnt damit eine Reichweite vom Stroh in der Krippe bis in die Tiefen des Kosmos. Nicht von ungefähr haben die Gestirne seine Geburt angezeigt. Der Pantokrator, der Herr der Welt, der zugleich auch das Kind in der Krippe ist, hat die Maßstäbe gesetzt. Am Lichtmesstag feiert die Kirche die Dimensionen dieser Darstellung im Tempel liturgisch. Ein Grund, sich am Festtag über uns selbst, die wir ja nach SEINEM Abbild geschaffen sind und die Welt, in die wir gesetzt wurden, Gedanken zu machen. Helmut Müller schenkt uns Nachdenkliches zum Lichtmesstag über uns selbst und die Welt.
Das Universum, nur ein Blümchenmotiv in der Tapete unseres Bewusstseins?
Das Bild zeigt die Plakette der Raumsonde Pioneer 10, die seit 1972 schon über 50 Jahre unterwegs und das bisher am Weitesten vorgedrungene menschliche Artefakt im Weltall ist, sozusagen unser Personalausweis für kosmische Grenzwächter. Schon Blaise Pascal, dessen 400. (!) Geburtstag wir im letzten Jahr feierten, hat das Format geliefert, in das auch jüngst die Forderung Kardinal Ouellets gestellt werden müsste, nämlich die Koordinaten des Menschlichen auf der Grundlage der christlichen Offenbarung neu zur Sprache zu bringen. Und das heißt: Unsere Kleinheit und Größe, unser Tun und Lassen sollten wir messen an der unendlichen Größe Gottes, dann hätten wir einen Maßstab für unsere Gesetze, Verordnungen und auch den ganz individuellen Umgang von jedem oder jeder mit sich selbst:
„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt,“
heißt es schon in Psalm 8,4ff. In der frühen Neuzeit ist diese Antwort durch Blaise Pascal als Frage formuliert worden:
„Ich weiß nicht, wer mich in die Welt gesetzt hat, und auch nicht, was die Welt und ich selbst sind. Ich weiß nicht, was mein Körper, meine Sinne, meine Seele und selbst jener Teil meines Ichs sind, der denkt. Ich sehe überall nur Unendlichkeiten, die mich wie ein Atom und wie einen Schatten einschließen. Alles, was ich erkenne, ist, dass ich bald sterben muss; doch was ich am wenigsten begreife, ist gerade dieser Tod, dem ich nicht entgehen kann.“
Seit Augustinus hat niemand mehr in dieser existentiellen Weise so scharf über sich selbst, die Welt, ihren Grund oder Abgrund und Menschsein überhaupt nachgedacht wie Blaise Pascal, von dem diese Worte stammen. Erst im 19. Jahrhundert haben Sören Kierkegaard und Nietzsche wieder in dieser existentiellen Weise nachgedacht. Das 20. Jahrhundert knüpfte dann in Heideggers Fundamentalontologie, Jaspers Existenzphilosophie, Sartres Existentialismus und den christlichen Varianten Gabriel Marcels, Peter Wusts und Romano Guardinis an diese Weise, das eigene Menschsein selbst in den Mittelpunkt des Denkens zu stellen, an.
Im Nachdenken über uns selbst stehen uns nicht nur räumliche Unendlichkeiten gegenüber, wie sie Blaise Pascal thematisiert hat. Die interstellar kalten oder glühend heißen Unendlichkeiten, von denen er spricht, das Universum, ist vielleicht nur mit einem Blümchenmotiv in der Tapete eines Bewusstseins (!) zu vergleichen, das um den Sinn des Ganzen ringt und eine Idee besitzt, die alles Vorstellbare unendlich übersteigt und in dieser Idee den Seinsgrund von allem denkt, nämlich Gott. Der Urmeter in Paris, als Maß der Ausgedehntheit, und der Augenblick, als Maß der Zeit, sind schier aussichtslos, die Weite des Universums und noch weniger die Unendlichkeiten eines Bewusstseins zu begreifen, das wir glauben annehmen zu dürfen, das Grund der Unendlichkeiten ist, von denen Pascal spricht.
Denken im Spielfeld von Endlichkeit und Unendlichkeit
An die Unendlichkeiten Blaise Pascals und seine aktuellen Erweiterungen erinnert im 20. Jahrhundert auch der Heidegger-Schüler – und wie dieser aus Meßkirchen stammende, ehemalige Freiburger Religionsphilosoph – Bernhard Welte. Nach einem Ausspruch von ihm sind wir Spieler auf dem Spielfeld zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, wobei wir nach Pascal und der erweiterten aktuellen Erkenntnisse, nicht mehr „Wahrnehmen [als] eine[n] Schimmer der Mitte der Dinge“[1] – eben nach menschlichem Raum- und Zeitmaß. Diese Metapher vom Spieler und seine Positionierung auf dem Spielfeld, möchte ich noch durch eine weitere Metapher ergänzen, die Spielregeln, mit denen wir uns auf diesem Spielfeld bewegen. Die genannten Denker fühlen sich in der Mehrzahl auf diesem Spielfeld regelrecht ausgesetzt, nur auf sich selbst und in die Welt buchstäblich geworfen. Nur Gabriel Marcel, Peter Wust, Romano Guardini und Bernhard Welte entscheiden sich für ein Grundvertrauen, dass das Spiel nach Regeln auch gelingend geführt werden kann. Außer der Grundausstattung mit Vernunft, die alle genannten Denker annehmen, sind die Letztgenannten davon überzeugt, dass es nicht unvernünftig ist, ein Zusammenspiel von Vernunft mit einem Glauben an einen Urgrund bzw. tragenden Grund anzunehmen, dass die Endlichkeit des Spielfeldes nicht in einem Abgrund endet und sich eben eine Unendlichkeit auftut und Menschsein den Anforderungen dieser augenscheinlichen Ausgesetztheit Stand halten kann.
Vorspiel der Vernunft im Universum
Mit bloßer Vernunft kann ein fundamentales Architekturprinzip der Natur angenommen werden. Dieses Prinzip begegnet jeweils schon in „Anfängen“ – sowohl astrophysikalischen, als auch in der Stammesgeschichte evolutionsbiologischen und in unserer persönlichen Entwicklungsgeschichte embryogenetischen Anfängen bis in weitere Stadien einer komplexen Anthropogenese hinein, in der ein bloßes Strukturprinzip personal angeeignet und verwirklicht werden muss. In neuerer Zeit hat das richtigerweise zu einer Emanzipation der Frau geführt. Mittlerweile zeichnet sich aber am Horizont der Gegenwart eine Entmännlichung der Gesellschaft, der eine Maskulinisierung in anderen Segmenten der Gesellschaft entgegensteht, ab. Ebenso muss eine woke Vergleichgültigung und Vervielfältigung der Geschlechter genannt werden. Diesen gesellschaftlichen Ausprägungen konterkariert ein schon im Kosmischen beginnendes Architekturprinzip des Menschen. Menschsein selbst nennt Pascal das Milieu des choses – die Mitte der Dinge – die Spannungsmitte der Unendlichkeiten. Die moderne Astrophysik meint, den Menschen zwischen die „Unendlichkeiten“ von Quarks, Quanten und Quasare platzieren zu können.
Der bekannte Astrophysiker Harald Lesch meint dazu:
„Wie so vieles ist das Leben ein Resultat eines Fehlers, einer kleinen Asymmetrie. Das ganze Universum ist das Ergebnis einer kleinen Asymmetrie. Wenn alles perfekt wäre, würde es uns gar nicht geben.“
Mit Symmetrien und Asymmetrien erklären die Naturwissenschaften sehr viele Phänomene, fast alles. Das Standardmodell der Teilchenphysik – die am besten überprüfte Theorie von allen auf der Welt – ist ein mathematisches Modell, das auf Symmetrien und Asymmetrien fußt. Ähnliches lässt sich evolutionsbiologisch – mit einem interessanten Blick auf Gen 3 sagen: Der Tod kam mit dem Beginn der Asymmetrie – von Männlichem und Weiblichem – in die Welt: Die nichtsexuelle Vermehrung von Einzellern verlieh denselben bis dahin Unsterblichkeit, mit heterosexuellen Zwei- und Mehrzellern kam die Sterblichkeit in die Welt.
Vorspiel des Glaubens im Paradies
Das scheint sich im Zusammenspiel von Glaube und Vernunft, Gen 2 und 3 genial abzubilden: Nach dem geschlechtlich undifferenzierten, zunächst unsterblichen Erdling Adam setzt Gott in seinem Schöpfungsakt neu an und differenziert den Erdling asymmetrisch (!) in Mann und Frau mit der Folge der Sterblichkeit beider, was aber heißt, dass in Bezug auf Gleichwertigkeit und Würde der Geschlechter eine Symmetrie zu gelten habe.
Wo komm’ ich her? Was soll ich hier? Wo geh’ ich hin? Wer bin ich eigentlich? So scheint der Adam des Salzburger Missale sich seiner selbst zu vergewissern, als er in der Schöpfung Gottes zum ersten Mal die Augen aufschlägt und sein asymmetrisches Gegenüber Eva wahrnimmt. Er muss sich als ein Original vorgekommen sein unter behaarten Vierfüßlern, befiederten Zweifüßlern und beschuppten Wassertieren. Die Welt um ihn herum wirkt paradiesisch, nichtsdestotrotz fühlt er sich einsam, weil nichts um ihn herum wirklich zu ihm passt. Gott aber muss ein Einsehen mit ihm gehabt haben, lässt einen Tiefschlaf über ihn kommen, und als er wieder wach wird, erlebt er sich als Beziehungswesen zu Zweien, die aus einem und zu einem Fleisch geworden sind und wieder werden.
Vor nicht ganz dreitausend Jahren haben Menschen damit begonnen, eine Antwort zu erzählen auf Fragen, die womöglich nicht erst in kantischem Format neuzeitlich gestellt worden sind. Möglicherweise hat sich zunächst nur eine Frage gestellt, nämlich: „Wo geh’ ich hin?“ „Wo komm’ ich her?“ schien sich archaischem Menschsein sinnfällig zu beantworten und „Was soll ich hier?“ ist erst mit Blaise Pascal neuzeitlich wirklich zur Frage geworden.
Ist der Tod das Endspiel von Glauben und Vernunft?
Bleibt also das Wo geh’ ich hin? In ein ewiges Nichts? Das war unvorstellbar. Jede Bestattung mit Beigaben, schon die älteste, ist ein Protest gegen ein ewiges Nichts. Tot sein schien das Rätsel schlechthin (Hans Jonas) zu sein, das sich nur als Weiterleben in anderer Weise zu lösen schien.
Die Antwort auf diese gestellten oder auch nicht gestellten Fragen war offensichtlich so faszinierend und erschöpfend, dass sie sich bis zu uns erhalten haben und sich im Kernbestand als Ursprungserzählung sogar in den drei großen abrahamitischen Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam mit mehr Gemeinsamkeiten als Unterschieden erhalten hat. Drei Milliarden Menschen kennen diese Erzählung aus dem Fundus ihrer Überlieferungen und wohl die überwältigende Mehrheit von ihnen glaubt sie auch in einer von vielen Versionen, die sich vor allem in den letzten Jahrhunderten vielfältig aufgefächert haben und sich einer Auseinandersetzung zwischen Glauben und Vernunft verdanken. In christlich-abendländischer Terminologie geht es um die „Klärung des Verhältnisses bzw. der Zuordnung von ‚Glaube und Vernunft’, und zwar unabhängig davon, wie diese Zuordnung im einzelnen konzipiert wird, ob als gegenseitige Ergänzung, als schroffer Gegensatz, als wechselseitige Durchdringung oder als Aufhebung des einen in das andere.“[2] Glauben zusammen mit Vernunft sind die Spielregeln, die nach und nach entwickelt wurden. Erst im Nachhinein kam es zu einer Ausdifferenzierung, die sogar in einer eigenen Enzyklika – Fides et Ratio – ihre kirchlich bevorzugte Form erhalten hat.
Die Spielregeln Glaube und Vernunft
Die Vernunft wird durch den Glauben erhellt und der Glaube mittels Vernunft kritisch ausgelegt. Glauben und Vernunft haben nämlich miteinander gemeinsam, dass sie eigentlich auf Wahrheit ausgerichtet sind. Die neuzeitliche Vernunft hat diese Ausrichtung zwar aufgegeben und hat Nietzsches Position des Eckenstehers eingenommen: Wahrheit löst sich auf in die Vielfalt der Perspektiven ihrer Betrachter. Religiöser Glaube kann allerdings auf Wahrheit nicht verzichten. Wahrheit kann man zwar nicht wissen aber man kann sie vernünftig bekennen. Kenner der Materie werden bemerken, dass der Verfasser aus einem katholisch geprägten Verstehenshorizont heraus schreibt.
Wenn wir fragen, was der Mensch ist, wird unsere Vernunft letztendlich frustriert. Nur der Glaube kann Antwort geben. Erst dann kommt die Vernunft wieder ins Spiel und ist gefragt, wie lässt sich mit diesen Vorgaben des von mir gewählten Glaubens auf dem Spielfeld zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit sinnvoll und vernünftig leben.
Das Maß des Kosmischen und Menschlichen: Christus
Benedikt XVI. hatte einmal vor römischen Priestern, schon 2006 davon gesprochen,
„dass heute die Menschheit auf der Straße von Jerusalem nach Jericho unterwegs den Räubern begegnet. Der gute Samariter hilft ihr mit der Barmherzigkeit des Herrn. Wir können nur betonen, dass es am Ende der Mensch ist, der unter die Räuber fällt, und dass es Christus ist, der uns heilt. Wir sollen und können ihm helfen im Dienst der Liebe und im Dienst des Glaubens, der auch ein Dienstamt ist.“
Kardinal Fernandez hat jedenfalls schon angekündigt, dass ein neues Schreiben sich mit dem in unserer Zeit so heftig attackierten Menschenbild befasst. Der in ärmlichen Verhältnissen Mensch gewordene Gott, dessen Darstellung im Tempel liturgisch am 2. Februar bevorsteht, möge uns helfen unser Menschsein in der Welt, im Kosmos und auch in uns selbst richtig zu verstehen, so wie der greise Simeon, als er das Kind im Tempel sah:
„Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.“ (Lk 2, 29-32.)
Eine Sehnsucht und Erfüllung, nicht in Richtung auf einen Transhumanismus durch „kluge“ Technik, sondern – wenn die Vorsilbe „trans“ einen Sinn ergeben soll – in der gläubigen und tätigen Nachfolge Christi, auch in seiner Eigenschaft als Pantokrator.
[1] Pascal, Blaise: Pensées, Paris 1937, S. 36; im franz. Original: „quelque apparence du milieu des choses“.
[2] Grätzel Stephan/Kreiner, Achim: Religionsphilosophie. Stuttgart 1999, 1.
Philosoph und Theologe, akademischer Direktor am Institut für Katholische Theologie der Universität Koblenz. Autor u.a. des Buches „Hineingenommen in die Liebe“, FE-Medien Verlag