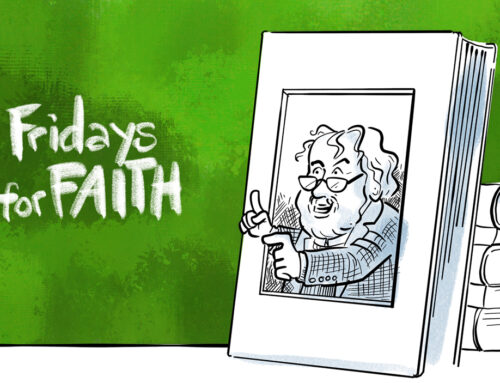Deutsch-Römische Gespräche: Stahlfaust im Samthandschuh
„Diplomatie ist Machtpolitik in gesitteter Gestalt“ sagt der altgediente eidgenössische Diplomat und Historiker Paul Widmer in seinem ebenso materialreichen wie spannenden Kompendium zur Kunst diplomatischer Beziehungen zwischen den Staaten. Dass Rom diese Kunst auch innerkirchlich nach wie vor brillant beherrscht, zeigt das in einem Kommuniqué niedergelegte Ergebnis der ersten deutsch-römischen Gesprächsrunde: Ohne die deutschen Bischöfe zu demütigen, wird klar, wer am Ende des Tages die Hosen an hat. Martin Brüske analysiert.
Approbation
Wer approbiert, der regiert. Denn er sagt zuletzt und entscheidend, was Recht und Theologie am Ende wirklich bedeuten. Der, der das Recht zur Approbation zugesteht, anerkennt damit – wohl oder übel – genau diese Kompetenz. Er gibt das Recht, selber zu sagen, ob er in seinem Tun dem Recht und der theologischen Identität der Kirche entspricht, aus der Hand. Die Frage „Quis judicat?“, also: „Wer hat die Kompetenz, letztentscheidend zu urteilen?“ ist dann beantwortet. Und damit: Wer bestimmt am Ende des Tages die Sache?
Die nach Rom zu Gesprächen mit drei Dikasterienchefs gereiste deutsche Delegation hat genau dieses entscheidende Zugeständnis gemacht. So wurde es gestern gemeinsam und offiziell kommuniziert. Zwar wird man auf deutscher Seite sagen, dass man dies selbstverständlich immer so gesehen hat. Man sei ja schließlich katholisch und wolle kein Schisma… Praktisch und faktisch sah es anders aus. Römische Einhegungsversuche mit rechtlicher Verbindlichkeit und klaren Verweisen auf die Ekklesiologie des Konzils und das geltende Kirchenrecht wurden als mehr oder weniger unverbindliche Meinungsäußerung, die dann auch die Protagonisten in ihrem Handeln nicht weiter kümmerte, abgetan. Das änderte sich erst mit dem römischen Brief vom 16.2.24: Die deutsche Kirche stand am Abgrund.
Ende des Gezerres
Und immer war die Deutung auf deutscher Seite: Die tumben Römer haben nicht richtig gelesen und nicht richtig verstanden. Selbstverständlich werde man Ausschuss und Rat kirchenrechtskonform konstruieren. So das bis zur Ermüdung wiederholte Wording. Nur: Die Konstruktion mit der salvatorischen Anstandsformel, dass Rechtsverbindlichkeit der Entscheidungen (!!) erst durch einen entsprechenden Akt des einzelnen Bischofs entstehe, entsprach erkennbar nicht der Intention. Die gab früh Thomas Sternberg zu Protokoll – der Bischof, der sich verweigert, hat mit Druck zu rechnen – und zuletzt Irme Stetter-Karp. Für sie ist echte Entscheidungskompetenz conditio sine qua non der weiteren Kooperation des ZdK – und sie meinte gewiss nicht Entscheidungen, die dann doch keine wirklichen Entscheidungen sind, weil ihre Verbindlichkeit in der Schwebe bleibt. Mit einem Wort: Weil man nicht begreift und begreifen will, was authentische Synodalität eigentlich ist – die gemeinsame Suche nach dem Willen Gottes heute, die zu einem geistgewirkten Ereignis des Konsenses jenseits von Parlamentarismus führen soll und mit dem Bischof als Träger der letzten Unterscheidung in einem geistlichen Prozess – versuchte man die Quadratur des Kreises: Äusserlich ein rechtlicher Notausgang, innerlich Druck und Nötigung zur „Verbindlichkeit“ von Entscheidungen.
Die Vorgaben des Konzils zählen
Gestern jedoch wurde dieses Gezerre zwischen Rom und Deutschland im Prinzip beendet: Die Approbationskompetenz und damit die Kompetenz festzustellen, ob der deutsche Weg rechtlich und vor allem theologisch „sauber“ ist, hat zuletzt Rom. Man muss sich klarmachen: Wenn sich – was nicht anzunehmen ist – die Rechtsauffassung und die theologische Sicht in Rom nicht geändert haben, dann gilt diese Auffassung und Sicht, wie sie auch bisher schon, zuletzt im Brief vom 16.Februar, mehrfach geäußert wurde. Das heißt bei Licht: Weder „Entscheidungen“ durch „gemischte“ Gremien aus Laien und Bischöfen noch die unmögliche konkurrierende „Selbstbindung“ (gegenüber der synchronen und diachronen Bindung an das Kollegium der Bischöfe und in besonderer Weise an den römischen Bischof) und die Delegation von Wesenspflichten an ein Gremium durch die Bischöfe kann es geben. In diesem Licht sind die drei inhaltlichen Kriterien, die das Kommuniqué nennt zu lesen: Die entscheidende Bindung an die theologische Vorgabe der Ekklesiologie des Konzils. Sie ist entscheidend. Nicht nur die äußerliche Rechtskonformität. Dann erst, aber natürlich auch selbstverständlich, die Bindung an das auf dieser Basis und in diesem Licht stehende Kirchenrecht. Und schließlich die Bindung an den gegenwärtigen universalkirchlichen Prozess synodaler Selbstfindung in der Synode.
Ohne Demütigung in die Verantwortung entlassen
Was bekommen die Deutschen? Zunächst: Sie wurden nicht gedemütigt. Sie erhalten die Chance, den Weg aus der Sackgasse, in die sie geraten sind, selbst zu finden. Sie dürfen Wege zur Synodalität auch der deutschen Kirche suchen – aber nach von Rom definierten theologischen und rechtlichen Kriterien und mit römischer Approbation als conditio sine qua non. Deshalb konnte Rom auf einen direkten Abbruch mit entsprechend heftigen Folgen in Deutschland gelassen verzichten. Deshalb kann es sogar bei den Wörtern „Ausschuss“ und „Rat“ bleiben. Es wird darauf ankommen, wie sie gefüllt werden und ob sie den universalkirchlichen Vorgaben genügen, um in Rom akzeptiert zu werden. Das bedeutet auch: Rom lässt sich den „schwarzen Peter“ nicht zuspielen, sondern spielt mit diplomatischer Eleganz, mit der Stahlfaust im Samthandschuh, aber auch fair (angesichts etlicher Tricksereien und unfairer Finten auf deutscher Seite) die Karte zurück. Allerdings eben unter klaren Vorgaben und dem römischen Vorbehalt der Approbation. Schon jetzt ist klar: Dieser Weg wird kein leichter sein. Ob er gelingt, bleibt offen. Kardinal Fernández hat im Dezember eine Reise der Umkehr mit den deutschen Bischöfen angekündigt. Es ist verrückt: Eigentlich haben die deutschen Bischöfe nur eine Chance, wenn sie sich jetzt tatsächlich besinnen auf eine authentische Form von Synodalität – die mehr und anderes ist, als die Durchsetzung einer Agenda mit Mehrheiten und Minderheiten. Vielleicht geschieht das geistliche Wunder, das im Ereignis eines geistgewirkten Konsenses besteht, ja auch noch einmal in Deutschland.
Dr. theol. Martin Brüske
Martin Brüske, Dr. theol., geb. 1964 im Rheinland, Studium der Theologie und Philosophie in Bonn, Jerusalem und München. Lange Lehrtätigkeit in Dogmatik und theologischer Propädeutik in Freiburg / Schweiz. Unterrichtet jetzt Ethik am TDS Aarau.
Beitragsfoto: Adobe Stock