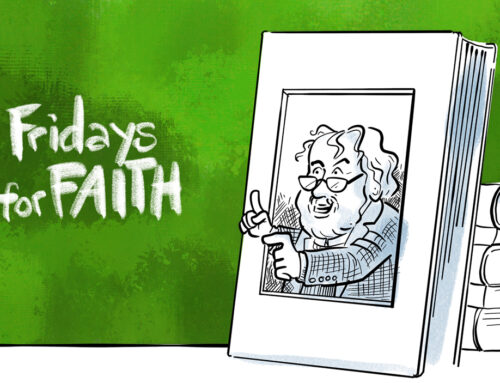Als Kardinal Joseph Ratzinger zum Papst gewählt wurde, galt diese Personalie in der deutschen Presse vielfach als „umstritten“. Vielleicht ist es anlässlich seines Todes hilfreich, an sein Verhältnis zu den Juden zu erinnern.
Wenn der helle Rauch aufsteigt, zum Zeichen, dass sich das Konklave der Kardinäle auf einen neuen Papst geeinigt hat, laufen die Römer auf dem Petersplatz zusammen, heute wie seit Jahrhunderten. Und nun war es dieser, il tedesco, der Deutsche. C‘è un attimo di silenzio di troppo, nella piazza…schrieb eine italienische Zeitung: Unten auf dem Platz, bei Bekanntwerden der Nachricht, sei ein Augenblick des Schweigens zu viel gewesen.
Ausgerechnet ein Deutscher
Dies die feine italienische Art, jene Verblüffung zu beschreiben, die große Überraschung oder, wie man im Deutschen sagt, das „ungläubige Staunen“, das offenbar einen Augenblick lang über dem Platz gelegen hatte. Für das Staunen der Römer gab es zunächst einen historischen Grund: Selten in der Geschichte der Päpste sind Nicht-Italiener auf den Heiligen Stuhl gelangt, und nun gleich zwei hintereinander. 1978 der Pole Karol Wojtyla, der erste Ausländer seit Hadrian VI., seit rund vierhundertfünfzig Jahren also, und jetzt sein Nachfolger Josef Ratzinger, ein deutscher Kardinal. Poi l’applauso, certo. Abbiamo il Papa, viva il Papa. Viva questo Papa, viva Benedetto sedicesimo, il tedesco.
Anderswo hatte das Erstaunen andere Gründe, und die Medien, die Sprachrohre jener unwägbaren, unbeirrbaren, dennoch oft irrenden Kraft, die sich „öffentliche Meinung“ nennt, fanden drastischere Worte. Dabei ist erstaunlich, wie verschieden die Beurteilungen des neuen Pontifex ausfallen, von unverhohlener Begeisterung bis zu Beleidigungen. Es werde schwer sein, diesen Papst zu lieben, erklärte ein brasilianischer Befreiungs-Theologe sofort nach der Wahl, während die Mailänder Zeitung Corriere della Sera seine große Beliebtheit voraussagte: Sarà un Papa amato.
Kardinal Joseph Ratzinger, seit fast fünfundzwanzig Jahren Präfekt der Glaubenskongregation und Präsident der Theologenkommission der katholischen Kirche, galt als „konservativer Chefdenker“ des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Bereits dieser hatte – trotz seiner weltweiten Popularität – manche liberale Hoffnung enttäuscht. Erst recht nun der Mann, der als federführend bei den grundlegenden vatikanischen Erklärungen der letzten zwei Jahrzehnte gilt, etwa bei dem 1992 veröffentlichten Katechismus der Katholischen Kirche oder dem viel kritisierten päpstlichen Papier Dominus Jesus aus dem Jahre 2000. Oft hätten Ratzingers Entscheidungen den „Geist des Verbohrten geatmet“, schrieb ein deutscher Journalist, Ratzinger sei ein „Betonkopf“, ein anderer, und die Pariser Zeitung Libération bezeichnete ihn als „Panzerfahrzeug Gottes“. Der Zürcher Tages-Anzeiger – alte Ängste vor der katholischen Kirche ausspielend – nannte ihn einen „Großinquisitor“. In Anlehnung an kommunistische Propagandasprache verurteilten ihn der Londoner Independent oder die dänische Zeitung Politiken als „reaktionäre Gestalt“. „Vielen Katholiken und Christen“, so der Berliner Tagesspiegel, „läuft beim Namen Ratzinger wegen seiner harten Art ein eiskalter Schauer über den Rücken.“
Kritik aus Mitteleuropa, Sympathie bei Juden
Die negativen Stimmen kommen vor allem aus Europa, genauer aus Mittel- und Nordeuropa. Dort gibt es Kirchenaustritte in alarmierender Zahl, eine zunehmende Abwendung vom Christentum, einen spürbaren Verlust an Tradition und historischem Bewusstsein, zugleich scheint ein verbohrter Euro-Zentrismus viele Mitteleuropäer an der Einsicht zu hindern, dass die Welt nicht nur aus Mitteleuropa besteht. Schon eine ost-europäische Stimme, die ungarische Zeitung Magyar Nemzet, wertete den neuen Papst vollkommen anders: „Die Botschaft des Heiligen Geistes an das Konklave war: Lasst uns die Kirche panzern, denn wir dürfen Europa nicht aufgeben.“
Ich zitiere diese Stimmen als Außenstehender, der weder in Europa lebt noch irgendeiner Richtung christlichen Glaubens angehört. Israel, das Land, in dem ich lebe, war eins der wenigen weltweit, in dem die Wahl Kardinal Ratzingers zum neuen Papst mit fast ungetrübter Zustimmung begrüßt wurde. Seine Mitgliedschaft in der Hitlerjugend – für europäischen Zeitungen Grund zu bedrohlichen Schlagzeilen – wurde in israelischen Medien nur kurz, eher pflichtschuldig, unter Hinweis auf die Unmündigkeit des Knaben abgehandelt. Dafür gab es ausgiebige Würdigungen der Verdienste des Kardinals und Theologen bei der christlich-jüdischen Annäherung und der Anerkennung des Staates Israel durch den Vatikan. Bekannte Rabbiner und der Vorsitzende des jüdischen Weltkongresses erklärten Ratzingers Wahl für „good news“. Man möchte von einem Paradoxon sprechen: ein in der eigenen Heimat als „Reaktionär“ und „Großinquisitor“ bezeichneter Theologe genießt weitreichende Sympathien im jüdischen Staat und bei jüdischen Organisationen in aller Welt.
Heilung eines alten Bruchs
Die diplomatische Anerkennung des jüdischen Staates durch den Vatikan erfolgte 1993. Dahinter stand mehr als politische Vernunft angesichts der wachsenden Stärke und Bedeutung des Staates Israel in der mittelöstlichen Region und in der Welt. Tiefe theologische Arbeit ging in diesem Fall der diplomatischen voraus: es galt zweitausend Jahre Zerwürfnis zu überwinden, Jahrhunderte währende Fehlurteile der Kirche gegenüber dem Judentum, Jahrhunderte christlichen Judenhasses und christlicher Judenverfolgung. Die Heilung des aus der Antike stammenden Bruches der Kirche mit dem Judentum war, unter Ratzingers ständiger Beratung, das wohl wichtigste theologische Projekt im Pontifikat seines Vorgängers Johannes Paul II. Die von Kardinal Cassidy geleitete Vatikanische Kommission für die Beziehungen zum Judentum veröffentlichte 1994 ihr mea culpa für das Versagen der Kirche im Holocaust. Die Erklärung wies darauf hin, dass dieses Versagen aus der langen Tradition des christlichen Judenhasses erwachsen und tief in der Kirchengeschichte verwurzelt war.
Bei der Annäherung des päpstlichen Staates an den der Juden ging es um mehr als ein mea culpa wegen Auschwitz. Die Wurzeln des christlichen Anti-Semitismus reichen viel tiefer, viel weiter zurück. Sie reichen in frühes kirchliches Selbstverständnis, mindestens bis zur Passa-Homilie des Bischofs Melito von Sardis, geschrieben um 150 christlicher Zeit, in der „die Juden“ zum ersten Mal offen als Christusmörder bezeichnet wurden, obwohl Melito und anderen frühchristlichen Judenfeinden bekannt war, dass nur der römische Prokurator von Judäa Todesurteile verhängen und nur die römische Behörde sie vollstrecken konnte. Der einflussreiche christlich-römische Philosoph Laktantius folgte der Unwahrheit zwei Jahrhunderte später in seinem Standardwerk Divinae Institutiones, wodurch sie ins lateinische Schrifttum einging. Ambrosius von Mailand im vierten Jahrhundert, die Kirchenväter Johannes Chrysostomos (Homiliae adversus Iudaeos) oder Augustinus (Tractatus adversus Iudaeos) kennzeichnen weitere Etappen der Kirche auf dem abschüssigen Weg in Judenhass und Verfolgung des Volkes Jesu. Hinzu kamen tendenziöse Übersetzungen auslegbarer Stellen im Neuen Testament (Matthäus 27, 25, Titus 1,10-11 u.a.), die der Entstellung den Anschein des Unvermeidlichen gaben. „Sagen wir es direkt“, schrieb der Theologe und Papyros-Forscher Carsten Peter Thiede, „Übersetzungen und Ausleger, die sich darauf stützten, haben hier Schuld auf sich geladen.“
Christlicher Judenhass durch Jahrhunderte manifestiert
Christlicher Judenhass verfestigte sich durch die Jahrhunderte zu einem scheinbar unerlässlichen Bestandteil christlicher Weltsicht. Auch Reformatoren wie Luther, bei allem Widerstand gegen die katholische Kirche, übernahm ihn fast unbesehen. Gelegentlich versuchten Theologen, einige Male sogar Päpste, das verhängnisvolle Stereotyp zu brechen. Pius II. war ein Freund der Juden, Martin V. erließ nicht weniger als fünf Bullen zu ihrem Schutz. Sixtus V. sicherte sie 1587 durch die Bulle Christiana Pietas. Doch es blieb bei einzelnen Initiativen, nicht wirklich durch theologische Grundsatzarbeit untermauert, immer wieder durch Rückfälle zunichte gemacht. Papst Leo XII. konnte die römischen Juden im 19.Jahrhundert erneut ins Ghetto verbannen, noch Pius IX., einige Jahrzehnte später, fiel in die alten Vorurteile zurück.
Wie tief der unsinnige Hass auf das Volk, dem Jesus angehörte, dem Christentum geschadet hat, enthüllte das 20. Jahrhundert, das die offiziellen Kirchen unfähig sah, dem beispiellosen Verbrechen der europäischen Judenvernichtung entgegenzutreten: aus eigener Verstrickung heraus, aus eigener Mitschuld an der theologischen und psychologischen Vorbereitung des Ungeheuerlichen. Die europäischen Kirchen verloren ihre Glaubwürdigkeit als Institutionen, die für die Wahrung des Humanen einstehen müssen, gerade in Tagen des gewalttätigen Angriffs gegen die Menschlichkeit. Unmittelbar auf diese Schwäche folgte ihr Niedergang in vielen europäischen Ländern. Es ist offenkundig, dass hier ein Zusammenhang besteht: zwischen der Mitschuld, dem Verlust an Glaubwürdigkeit und der Einbuße an Bedeutung im heutigen geistigen Leben Europas. Ein Ausweg aus der Misere führte nur über Gewissenserforschung und das Eingeständnis eigener Schuld. Und tiefer noch: über das Bloßlegen der bis in die Antike reichenden Wurzeln christlicher Feindseligkeit gegenüber dem Volk der Juden.
Es brauchte einen konservativen Denker
Zu den tiefsten Denkern auf diesem Gebiet gehört seit langem der deutsche Theologe Josef Ratzinger. Vielleicht hat der Umstand, dass er ein Deutscher ist, daran wesentlichen Anteil. „Man könnte seine Sensitivität auf diesem Gebiet, entstanden aus der Gewissenserforschung eines in Deutschland Geborenen, mit der seines Vorgängers Johannes Paul II. vergleichen, der in Polen geboren wurde, einem der ‚Opferländer‘ Nazi-Deutschlands“, schrieb die amerikanische Journalistin Lisa Palmieri-Billig in Rom. „Der frühere und der künftige Papst scheinen verbunden durch ihre gemeinsamen persönlichen Erinnerungen an die Verbrechen des Holocaust.“
Dies war vermutlich nur die äußerste Schicht einer viel intensiveren geistigen Nähe zwischen dem verstorbenen polnischen Papst und seinem Berater in theologischen Fragen, dem deutschen Kardinal. Um die tiefen Ursachen des katholischen Judenhasses zu durchschauen, muss man – so paradox es klingen mag – ein konservativer Denker sein. Kardinal Ratzinger hat 1990 in einem Interview den nucleus christlicher Judenfeindschaft bloßgelegt. Er sprach über seine Bemühungen, „die alten legalistischen Interpretationen der Schrift zu überwinden, die typisch sind für sogenannte liberale katholische Kreise, und die Jesus als jemanden porträtieren, der die pharisäische Interpretation der Schrift gebrochen hätte.“
In der Tat beginnt das christliche „Problem“ mit dem Judentum bei der Frage, ob Jesus ein pharisäischer Schriftgelehrter war, eingebettet in das rabbinische Judentum seiner Zeit, oder ob er mit der Tradition des Judentums gebrochen hat und sich gegen sie wandte, wie gerade moderne und linke Theologen behaupten. Ratzinger, als Konservativer, besteht auf einer „grundsätzlichen Kontinuität“ zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er sieht eine niemals unterbrochene Traditionslinie allen Denkens und Glaubens, das sich christlich nennt, aus dem Judentum heraus, aus dem mosaischen Gesetz, dem biblischen Wertekanon der Humanität.
Gestörtes Verhältnis der Christen zur eigenen Herkunft
Es gab Perioden in der Geschichte der katholischen Kirche, in denen energische, zum Teil gewaltsame Versuche unternommen wurden, das „Alte Testament“ vom Christentum abzutrennen, als etwas Reaktionäres, die Entwicklung Hemmendes, von Jesus selbst Verworfenes. Die Auslegung moderner Theologen, Jesus sei ein „Revolutionär“ gewesen, ein Rebell gegen die ihn prägende Überlieferung und pharisäische Tradition, hat solche Versuche begünstigt. Die Evangelien geben dazu keine Handhabe: sie porträtieren den Schriftgelehrten Jeshua oder Jesus als Anhänger des rabbinischen Lernhauses, aus dem er hervorging, vermutlich des Hauses Hillel, genauer von dessen Enkel Rabbi Gamliel, der, wie im Neuen Testament überliefert, auch Paulus‘ Lehrer war. In diesem streng schriftgetreuen Sinn soll der neue Katechismus der katholischen Kirche, veröffentlicht in den neunziger Jahren, die Position zum Judentum grundlegend klären. Der entscheidende Gedanke ist, wie Kardinal Ratzinger betonte, „dass ohne das Alte Testament, ohne Kontakt zu einem unsterblichen, alles überdauernden Judentum, das Christentum seinen eigenen Ursprüngen nicht treu sein kann“.
Der Theologe Ratzinger erweist sich als einfühlsamer Psychologe: die Identitätskrise des europäischen Christentums im 20.Jahrhunderts entstand, seiner Diagnose nach, nicht zuletzt aus einem gestörten Verhältnis zur eigenen Herkunft, den eigenen Wurzeln. Die Wurzeln des Christentums liegen im Judentum. Eine das Judentum verleugnende, womöglich hassende Kirche kann nicht gedeihen, nicht überzeugen. Sie kann, mit diesem inneren Defekt, der Unmenschlichkeit nicht wehren, ihre Botschaft nicht mehr glaubhaft erfüllen, nicht mehr wirksam in die Tat umsetzen. Es ist eine für manchen Christen schmerzliche Diagnose. Sie beinhaltet das Eingeständnis, aus einer anderen, älteren Religion hervorgegangen und dieser – als der Quelle eigener Identität – für immer verpflichtet zu sein. Seit jeher gab es Christen, denen dieses Eingeständnis unerträglich war. Doch die Krise der europäischen Kirchen im 20.Jahrhundert gibt Ratzinger Recht.
„Erwähltheit“ des jüdischen Volkes
Der verstorbene Papst Johannes Paul II., unter Ratzingers theologischer Beratung, ging den entscheidenden Schritt. Er bekannte sich, wohl als erster Papst in der Geschichte, zur umstrittenen „Erwähltheit“ des jüdischen Volkes. Bei seinem Besuch in Israel 1994 erklärte Ratzinger, warum für Christen die Anerkennung dieser Erwähltheit zwingend sei. „Das Volk Israel“, sagte er, „hat immer und ganz zu recht seine Überzeugung bewahrt, das ‚erwählte Volk‘ zu sein. Denn es war unser Einziger Gott, der diese Wahl getroffen hat, im Kontext eines universalen Plans, wie wir im Alten Testament gesehen haben.“
Und er fügte eine Aussage über die Rabbiner hinzu, wohl gleichfalls einzigartig in der Geschichte der römischen Kirche: „Aber die Tatsache ihrer Erwähltheit hat die Rabbiner der Antike oder des Mittelalters oder, mehr noch, der heutigen Zeit, nicht daran gehindert zu glauben, dass Gott zugleich seine Liebe allen Menschen zuteil werden lässt.“ Auch diese Erklärung ist revolutionär in der Geschichte der Kirche, die den Rabbinern fast unisono gerade die Fähigkeit abgesprochen hat: ihren Gott mit anderen zu teilen, offen zu sein, universal gesinnt, auf das Wohl der gesamten Menschheit bedacht.
Die Rabbiner galten der Kirche als eifersüchtige Hüter des jüdischen Gottes, ihr Denken als partikularistisch, zurückgeblieben, von Enge und Introvertiertheit bestimmt, und daher – im Unterschied zum römisch-christlichen Konzept – als außerstande, universellen Ansprüchen gerecht zu werden. Anders sah es der Theologe Ratzinger: im Erwähltheits-Bewusstsein der Juden argwöhnt er nicht – wie viele christliche Theologen bis heute – Arroganz, Dünkel oder sonst eine separatistische Attitüde, die das rabbinische Judentum daran hindert, sich zu öffnen und für die „Meinung der Mehrheit“ zugänglich zu werden, sondern göttliche Zuweisung, ein auferlegtes fatum, das der davon Betroffene, ob er will oder nicht, annehmen muss, und mit ihm alle, die sich zu diesem Gott bekennen.
Die Person Jesu als neuralgischer Streitpunkt
Der neuralgische Punkt im Verhältnis der Christen zu den Juden liegt wiederum tiefer, liegt seit jeher, seit frühestem christlichen Selbstgefühl, in der Nicht-Anerkennung der Person Jesus als Messias, auf griechisch Chrestos, durch das Judentum. Hieran entzündete sich die Rhetorik einiger Sprecher, Briefschreiber und Überlieferer im Neuen Testament, Juden zumeist, später von christlichen Autoren und Kirchenvätern. Dabei sei nicht vergessen, dass Jesus‘ erste, früheste Anhängerschaft durchweg aus Juden bestand, und dass es eben gerade viele Juden waren, die in ihm den Messias oder Chrestos sahen. Dass die Sadduzäer und Tempelpriester dagegen Stimmung machten und beim ohnehin durch Jesu Auftreten gereizten römischen Statthalter ein offenes Ohr fanden, hat wiederum christliche Judengegner über Jahrhunderte zu einer pauschalen Verurteilung „der Juden“ verführt. Man kann von einer inner-jüdischen Spaltung sprechen, von einem inner-jüdischen Streit, ausgelöst durch den umstrittenen Schriftgelehrten und Wunderheiler Jesus, und die entscheidende Streitfrage war, ob man in ihm mehr sah als einen Schriftgelehrten und Heiler, ob man in ihm den von Gott Gesalbten sah, eben den Chrestos oder Messias.
Ratzinger vertrat auch hierzu eine für einen katholischen Theologen verblüffend neuartige Sicht. Er hat sie nicht für sich behalten, sondern schriftlich niedergelegt, in seiner Einleitung zu einem der maßgeblichen Papiere der Päpstlichen Bibel-Kommission, der er seit 1981 vorstand. Rabbi David Rosen, von jüdischer Seite an den Vorbereitungen zur Eröffnung diplomatischer Beziehungen zwischen dem Vatikan und Israel beteiligt, erinnert sich, wie er Kardinal Ratzinger einst auf die Bedeutung dieses Dokuments ansprach, das Jahrhunderten christlicher Judenfeindschaft den Boden entzieht, und wie Ratzinger darüber in ein „breites Lächeln“ ausgebrochen sei.
„Er argumentierte“, erklärte Rabbi Rosen, „dass diese Haltung (die Nichtanerkennung Jesu als Messias – Ch.N.) gleichfalls Bestandteil des göttlichen Plans sei, und der Umstand, dass die Juden Jesus nicht akzeptierten, nicht als ein Akt gesehen werden dürfe, Gott zurückzuweisen, sondern als Teil von Gottes Plan, die Welt daran zu erinnern, dass Frieden und allgemeine Erlösung der Menschheit noch fern sind.“ Erstaunt fügte Rosen hinzu: „Das ist verblüffend. Er nahm etwas, das seit Jahrhunderten als einer der Hauptgründe für die Verdammung des Judentums und des jüdischen Volkes hergehalten hatte, und verwandelte es in etwas von positiver theologischer Bedeutung.“
Israel Singer, der einstige Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses, ist der Meinung, dass Kardinal Ratzinger „der Mann (sei), der für Papst Johannes Pauls II. Entscheidung, Beziehungen mit Israel aufzunehmen, die theologische Untermauerung lieferte. Er löste das eigentliche Problem, die zweitausend Jahre alte theologische Frage. So veränderte er in den letzten zwanzig Jahren die zweitausend Jahre währenden Beziehungen zwischen Juden und Christen grundlegend.“
Die „Judenfrage“ als Selbst-Infragestellung des Christentums
Von den heutigen Juden, vor allem denen in Israel, gewann Ratzinger sein eigenes authentisches Bild, das seinen traditionsbewussten Ansatz einer Wertschätzung dieses Volkes bestätigte. In den Jahren vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen machte er einige stille Besuche in Israel. 1994 nahm er an der internationalen Konferenz „Religious Leadership in a Secular Society“ in Jerusalem teil. Bei dieser Gelegenheit betonte er öffentlich die besondere Bedeutung einer Annäherung zwischen der katholischen Kirche und Israel: „Die Geschichte der Beziehungen zwischen Israel und dem Christentum ist voller Blut und Tränen. Nach Auschwitz darf die Mission der Versöhnung und Anerkennung nicht länger aufgeschoben werden.“
Doch auch hier reichte dieses Mannes gedanklicher Ansatz tiefer. Auschwitz, so singulär dieses Verbrechen in der Geschichte dastehen mag, war wiederum nur Ausbruch von etwas viel Älterem und Tieferen. Die amtliche Bezeichnung für „Auschwitz“ war „Endlösung der Judenfrage“, und „Endlösung der Judenfrage“ hieß, dass europäische, christliche Gesellschaften immer noch mit einer „ungelösten Judenfrage“ laborierten, fast zweitausend Jahre nach Christus. Sie hatte sich zu einem monströsen Problem entwickelt und war längst keine „Judenfrage“ mehr, sondern zunehmend eine Selbst-Infragestellung christlicher Gesellschaften. Sie war Herd einer Krankheit des Christentums, einer Selbstzerstörung von innen. Angesichts des Holocaust hatte sich die alte „Judenfrage“ zugespitzt: zu einem Humanität und Christentum bedrohenden Phänomen.
Kein Volk wie jedes andere: Das „Volk Israel“
Von jüdischer Seite wurde mit der Gründung des neuen jüdischen Staates eine positive Lösung der „Judenfrage“ begonnen. Zugleich stellt die Rückkehr des verstreuten Volkes in die alt-neue Heimat wiederum ein theologisches Problem für viele Christen dar. Für die Kirchen war „Israel“ über Jahrhunderte nicht mehr das Volk der Juden, sondern die weltweite Gemeinde der Christen. Wenn Rabbiner und Pfarrer in den letzten zweitausend Jahren vom „Volk Israel“ oder von „Israel“ sprachen, meinten sie zwei verschiedene, einander ausschließende Menschengruppen. Auch an diesen heiklen Punkt wagte sich der Theologe Ratzinger heran, wissend, dass er für ein jüdisch-christliches Miteinander von Morgen entscheidend ist.
Befragt, ob der neue Staat Israel eine besondere Bedeutung für das Christentum hätte, erklärte er: „Ich denke ja, ohne damit voreilig theologische Schlüsse ziehen zu wollen, denn der israelische Staat entstand aus säkularem Denken heraus und ist selbst ein säkularer Staat. Aber dieses Geschehen hat große religiöse Bedeutung, denn dieses Volk ist nicht einfach ein Volk wie andere. Sie haben stets die Verbindung zu ihrer großen Geschichte gehalten, und deshalb finden sie sich heute wieder im Heiligen Land, dem Heiligen Land der Geschichte aller drei monotheistischen Religionen. Darin liegt selbstverständlich eine Botschaft für Christen.“
Ratzinger vertrat die These einer besonderen Rolle Israels unter den Völkern, er nannte als den für diese Besonderheit entscheidenden Grund: Israels auffallende Geschichtsverbundenheit, eine konservativ-kreative Haltung, aus der heraus, in einem gottgegebenen Augenblick, plötzlich ein großes Neues entsteht. Der spätere Papst erkannte das Revolutionäre in der Rückbesinnung, in der gedanklichen Rückkehr zur historischen Herkunft, zur spirituellen Quelle. Eine Kirche der Zukunft, davon war er überzeugt, findet diese Quelle im Judentum.
Wertschätzung der Juden auch nach seinem Tod
Nachtrag 2022: Es gibt viele verschiedene Sichtweisen auf Papst Benedikt XVI., auf den Theologen Josef Ratzinger, sein Wirken und sein Werk. Er wird auch jetzt wieder scharf kritisiert, gerade von Seiten deutscher Christen. „Der Streit um Benedikts Erbe beginnt“, verkündete das deutsche Leitmedium Spiegel schon einen Tag nach seinem Tod. Umso mehr fällt auf, dass auch diesmal von jüdischer Seite eine der dankbarsten Würdigungen kommt.
„Im Namen aller Bürger Israels sende ich mein tiefempfundenes Beileid aus Anlass des Ablebens von Papst Benedikt XVI,“ schrieb Israels Premierminister Netanyahu in einer an die „christliche Welt“ gerichteten Erklärung am Todestag. „Er war ein großer geistiger Anreger und fühlte sich ganz der historischen Wiederannäherung zwischen der Kirche und den Juden verpflichtet (…) In meinem Treffen mit ihm (2009 in Jerusalem) hörte ich ihn voller Wärme über das gemeinsame Erbe von Christen- und Judentum sprechen und über die Werte, die dieses Erbe der gesamten Menschheit hinterlassen hat. Wir gedenken seiner als eines treuen Freundes Israels und aller Juden.“
Chaim Noll
geboren 1954 in Berlin, wuchs als Kind kommunistischer Eltern im Ostteil der Stadt auf, 1972-74 Studium der Mathematik an den Universitäten Jena und Berlin, 1975-80 Studium Kunst/Kunstgeschichte Berlin, 1980 Wehrdienstverweigerung für DDR-Armee, Einweisung in psychiatrische Kliniken (insgesamt 9 Monate), 1983 Ausreise mit Frau und Kindern nach West-Berlin, 1984 erste Buchveröffentlichung, seit dem Erfolg seiner ersten Bücher meist als freier Autor, 1989-91 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FU Berlin, 1992 Übersiedlung nach Rom, von dort 1995 nach Israel, lebt seit 1997 mit seiner Familie in der Wüste Negev, 1998-2018 Writer in Residence/Dozent an der Ben Gurion Universität in Beer Sheva. Autor zahlreicher Bücher, Mitarbeiter bei Zeitschriften, Rundfunkanstalten und Internet-Blogs.