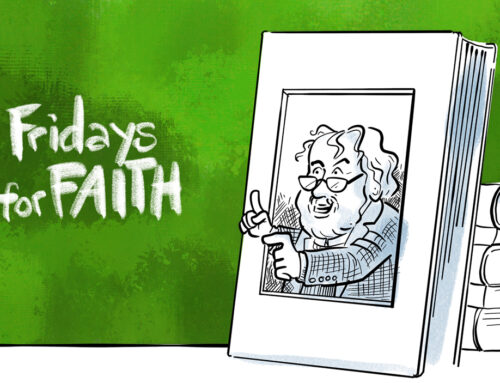Helmut Müller schreibt dem Essener Generalvikar Klaus Pfeffer einen Offenen Brief. Es geht um Spinat, Sex und Wissenschaftstheorie. Aber lesen Sie selbst.
Sehr geehrter Herr Pfeffer,
verzeihen Sie bitte, wenn ich Sie etwas indiskret nach Ihrer Kindheit frage: Mochten Sie Spinat? Möglicherweise erging es Ihnen anders als mir – und Sie blieben von Spinat verschont. Ich musste das grüne Zeug essen; Spinat – so hatte die Wissenschaft befunden – ist gesund. Dabei hätte mir eine genauere Betrachtung der Wissenschaft ein bis heute anhaltendes Spinattrauma erspart. Jahrzehntelang hatte man den Eisengehalt im Spinat durch einen Kommafehler falsch angegeben. Wir erkennen: Wissenschaftsglaube gemischt mit Mutterliebe, führt zu übergriffigen Handlungen an uninformierten Menschen. Nun ist die Kirche ja bekanntlich eine Mutter. Und Sie vertreten diese Kirche – mütterlich, väterlich, divers, wie auch immer – jedenfalls in einer gewissen Verantwortung für Menschen, die noch weniger informiert sind, als Sie es eigentlich sein müssten.
Warum belästige ich Sie mit der Spinatfrage? Natürlich geht es mir nicht um spinaciagene Neurosen. Ich möchte mit Ihnen ein wenig über Wissenschaftstheorie ins Gespräch kommen, hoffentlich mindestens so freundlich wie Sie mit dem Redetext des Nuntius umgegangen sind: Falsche Berufung auf Wissenschaft führt im kirchlichen Kontext zu ekklesiogenen Neurosen. Was Sie gerade tun – indem Sie die Anthropologie-Rede von Nikola Eterovic vor der deutschen Bischofskonferenz in die Tonne treten – und zwar unqualifiziert mit Hilfe von „Wissenschaft“ -, das kann ein kollektives Kirchentrauma auslösen. Deshalb lassen wir den Spinat und befassen wir uns mit einer stehenden Redewendung, die seit der Erfindung einer neuen Sexualmoral auf dem Synodalen Weg in vieler Munde ist, und eben auch von Ihnen angeführt wird. Eine neue Sicht auf den kirchlichen Umgang mit dem Sex sei notwendig, weil „humanwissenschaftliche Ergebnisse“ vorlägen, die eine andere Ethik zwingend notwendig machen würden. „Humanwissenschaftliche Erkenntnisse“ als Fakten zu verkaufen, das ist ein folgenreicherer Missgriff als ein falsch gesetztes Komma in der Spinatfrage. Sehen wir genauer hin!
Humanwissenschaftliche Erkenntnisse begründen keine neuen Lebensordnungen
Wie etliche andere (Moral-)Theologen machen Sie sich die Begriffsbildung zum Sachverhalt humanwissenschaftlicher Erkenntnisse entschieden zu einfach: Aus Lebenswirklichkeiten, sprich Sachverhalten wie einer faktisch vorhandenen gleichgeschlechtlichen sexuellen Anziehung oder dem Gefühl im falschen Körper zu sein, kann man keine alternativen Lebensordnungen generieren oder bisher allgemein anerkannte relativieren, gar negieren. Der Sachverhalt Farbenblindheit ist auch eine menschliche Lebenswirklichkeit, aber gewiss keine alternative Form des Sehens. Seit dem Logiker G.E. Moore (1873-1958) spricht man in der philosophischen Ethik vom „naturalistischen Fehlschluss“. Genau in diese logische Falle tappen Sie, wenn Sie von humanwissenschaftlichen Erkenntnissen sprechen und „entsetzt und tief getroffen“ auf die Verteidigungsrede der klassischen christlichen Anthropologie durch Nuntius Eterovic reagieren. Betroffenheit ist menschlich verständlich, aber als Sachargument in der Begriffsbildung wertlos. Der Nuntius, sagen Sie, wolle „humanwissenschaftliche Erkenntnisse zurückweisen“ und alle Bemühungen unterbinden, „innerhalb der katholischen Kirche differenziert, wissenschaftlich fundiert und damit auch in neuer Weise zu denken, zu reden und zu handeln.“
Über die Dogmatisierung humanwissenschaftlicher Erkenntnisse
Erkenntnisse aus der Empirie sind immer vorläufige Erkenntnisse, solche also, die so lange Gültigkeit haben, solange sie nicht falsifiziert werden. Wer „humanwissenschaftliche Erkenntnisse“ wie Dogmen behandelt, tut so, als gäbe es im Wirklichkeitserschließungsprozess der Wissenschaften Offenbarungen, die von der Science Community der Menschheit verbindlich zu glauben vorgelegt werden könnten.
Wo eine Reihe von deutschen Theologen sonst mit dem Dogma wenig mehr anzufangen weiß, will man mit einem „dogmatisch“ angewandten Begriff von humanwissenschaftlichen Erkenntnissen offenbar eine Brandmauer gegen lehramtliche Übergriffigkeit aus Rom und anderen Weltgegenden aufbauen: Der Nuntius bezieht von Ihnen Prügel (auch Bätzing sind dessen Ausführungen vermutlich „unerträglich“), aber Sie meinen natürlich Rom. Und Sie winden sich sichtlich um die Tatsache herum, dass der Nuntius permanent den Papst zitiert. Ihn direkt anzugreifen, war Ihnen doch wohl ein wenig zu riskant. Wahrscheinlich sind Sie auch der Auffassung von Thomas Söding, „dass unsere Expertise in der Weltkirche gefragt“ sei. Das dürfte Wunschdenken sein. Diese „Expertise“ eignet sich übrigens auch nicht zur Begriffsbildung von Sachverhalten.
Hätten Sie einmal über den deutsch-synodalen Kontext in die Welt hinausgeschaut, hätten Sie in der ganzen Frage des Umgangs mit nichtheterosexueller Sexualität von der australischen Kirche lernen können. Die Australier zeigten nämlich vorbildlich, wie man auch neueste humanwissenschaftliche Erkenntnisse als Fakten und Sachverhalte wahrnimmt, sie angemessen beurteilt und in das binäre christliche Menschenbild integriert, ohne bei einer neuen Sexualmoral oder einem existentialistischen Menschenbild zu landen.
Stehen humanwissenschaftliche Erkenntnisse der Südhalbkugel auf dem Kopf?
Einmal hat sich der Synodale Weg schon mit den Australiern befasst, freilich oberflächlich und geradezu gegen den originären Sinn. Im Handlungstext „Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt“ bezieht man sich auf das Papier der australischen katholischen Bischofskonferenz „Created and Loved. A guide for Catholic schools on identity and gender“. Deutschsynodal überschrieben, benutzt man den australischen Text gegen seinen Geist und Buchstaben als Schützenhilfe in der Verfestigung des eigenen Weltbildes. Referiert wird, wie die Bischöfe aus der Perspektive des christlichen Menschenbildes das Zueinander von biologischem und sozialem Geschlecht sehen würden: Schon im biologischen Geschlecht („sex“) zeige sich eine beachtliche Spannbreite, wie Menschen ihr Geschlecht erfahren und ausdrücken. So entwickle sich vom Zeitpunkt der Zeugung an in einem komplexen genetischen und hormonellen Prozess bereits pränatal für jede einzelne Person „a unique set of male or female characteristics“. Diese je einzigartige biologische Prägung als Mann und Frau verbinde sich lebensgeschichtlich mit dem sozialen Geschlecht („gender“). Das soziale Geschlecht werde selbst von vielfältigen Faktoren wie frühkindliche Erfahrungen, durch Erwartungshaltungen der Familie oder durch generelle kulturelle und gesellschaftliche Prägemuster beeinflusst. So komme es zu einer „much natural variation, in how individuals experience their masculinity or femininity“ (Anm. red.: zu „vielen natürlichen Variationen, wie Individuen ihre Männlichkeit oder Weiblichkeit erleben“). In bestimmten Fällen könnten sich, so die australischen Bischöfe, entgegenlaufende Erfahrungen zwischen biologischem und sozialer Geschlechtszugehörigkeit zu einer Krise der Geschlechtsidentität entwickeln. Halte diese Krise an, komme es in bestimmten Fällen zur Angleichung („transition“) der biologischen Geschlechtsmerkmale an das gefühlte und erfahrene Geschlecht. Die australischen Bischöfe dokumentierten ein Ringen mit humanwissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlichen Entwicklungen, das vor allem hinsichtlich der Konsequenzen für die Gestaltung kirchlicher Lernräume beachtlich sei.
Was die australische Bischofskonferenz tatsächlich schreibt
Während der Synodale Weg den australischen Text so liest, als müssten kirchliche Verlautbarungen umgeschrieben bzw. korrigiert werden, will der Text der australischen Bischöfe, dass neue Erkenntnisse im Rahmen christlicher Anthropologie beachtet werden sollten, und zwar ganz nach der Art, wie auch Naturwissenschaftler mit ihren Ergebnissen umgehen. Einstein hat es einmal so auf den Begriff gebracht:
„Erst die Theorie entscheidet, was man beobachten kann.“
Sollten der Theorie widerstreitende Ergebnisse vorliegen und eine neue Theorie erfordern, gilt die Beweislastregel: Das neu Erkannte trägt die Beweislast. Das heißt, die neue Theorie muss alte und neue Sachverhalte besser erklären. Das gilt auch für die Christliche Anthropologie: Das christliche Menschenbild entscheidet, wie neue Erkenntnisse der Humanwissenschaften zu beachten sind und in das Bild integriert werden können. Genau diesem Grundsatz folgt die australische Bischofskonferenz dann auch tatsächlich bis in die letzten Details ihrer Ausführungen.
Eine Sache – zwei Begriffe, aber welcher ist der richtigere?
Dazu ein Beispiel: Der Sachverhalt „biologisches Geschlecht und gefühltes Geschlecht divergieren“. Im Synodenpapier wird der Begriff Transgender gewählt, als wäre das eine neue Seinsweise und ein eigenes Geschlecht; die Australier schlagen aber vor, von Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie als Begriffen zu sprechen. Was bedeutet das? Die Australier gehen mit der Empirie und Lehrtradition der Kirche davon aus, dass es nur XX- und XY-Wesen gibt, Menschen aber eine mehr oder weniger kongruente Einstellung zu ihrem natürlichen Geschlecht haben oder entwickeln können. Im Synodenpapier reicht schon das bloße Vorkommen des genannten Faktums aus, um das Konzept der binären Geschlechtlichkeit aufzugeben. Bei den Australiern wird keiner Geschlechtervielfalt das Wort geredet. Es wird empfohlen, biopsychosozialen Modelle, die der katholischen Lehre entsprechen, als Handlungsleitlinien zu folgen und in der Lebenswirklichkeit vorkommende „geschlechtsspezifische Inkongruenz“ als psychosoziale Problematik zu werten und nicht als weitere Variante einer basalen binär verstandenen Geschlechtlichkeit zu sehen, die sich dann aber als objektiv zu bewertende Geschlechtervielfalt ausfaltet. Das Papier macht einen Unterschied zwischen Lebenswirklichkeit und Lebensordnung (man kann auch sagen: Schöpfungsordnung). Von der Verwendung von Cisgender u. a. Begriffen, die Geschlechtervielfalt präferieren, wird ausdrücklich abgeraten. Die Australier behalten das christliche Modell binärer Geschlechtlichkeit bei.
Alttestamentlicher Beistand aus Mainz für den Essener Generalvikar gegen den Nuntius
Der Mainzer Alttestamentler Thomas Hieke kommt Ihnen, Herr Generalvikar, zu Hilfe; er schlägt vor, das „männlich und weiblich“ im Text der Hl. Schrift als Bipolarität zu begreifen. Was meint er damit? Wohl, dass man nicht mehr von Männern und Frauen sprechen sollte, sondern dass Geschlecht etwas Schillerendes, Changierendes, Fluides ist und sich die Geschlechtsidentität gewissermaßen zwischen zwei Polen abspielt. Statistisch befänden sich die meisten Menschen nahe an den Polen. Das ist schon richtig, aber zugleich irreführend.
In der Schöpfungsgeschichte ist ganz offensichtlich die fruchtbare Begegnung der Geschlechter nicht statistisch, sondern final angezielt: „Seid fruchtbar und mehret Euch“ (Gen 1, 9, 7). Bei Tieren regelt das ein finaler Instinkt, bei uns als instinktreduzierten Wesen sollte das einer finalisierten Vernunftregulierung unterliegen. Das gleiche gilt in natur- und humanwissenschaftlicher, phylo- und ontogenetischer Hinsicht. Jede Spezies zielt final in ihren Individuen und ebenso in der Gattung Fruchtbarkeit an, auch wenn es statistische Ausreißer gibt, der Prozess ist allerdings final geleitet, weil das dem Sachverhalt entspricht. Lebenswirklichkeiten können statistisch wahrgenommen und sollten auch beachtet werden, sollten aber an Lebensordnungen ihr Maß nehmen und nicht statistische Ausreißer zu neuen Lebensordnungen stilisieren.
Statistische, demoskopische, gefühlte Normen?
Allgemein sollte gelten: So viel Freiheit wie möglich und so viele Regeln wie notwendig. Offensichtlich muss es da eine Spannbreite des Normalen geben, an der Freiheit ihre Grenzen findet und Regeln ihre Notwendigkeit. Der Normbereich kann auch nicht einfach die demoskopische und auch nicht die statistische Mitte sein, dann hätte die normale statistische Hand 5,ooo~1 Finger, weil es mehr Sechsfingrige als Vierfingrige – Arbeiter im Sägewerk nicht beachtet – gibt. Jeder weiß: Eine menschliche Hand hat final fünf Finger. Wie ist es mit Farbenblinden? Gibt es alternative Weisen des Sehens beim Menschen? Und wie ist es mit den Geschlechtern? Gibt es davon so viele, wie Gefühle dafür reklamiert werden? Werden dann Gefühle zum einzigen Kriterium? Um uns herum haben wir Kriterien für unser Handeln und unser Agieren: Die Umwelt, das Klima, die Ozeane; da gibt es jede Menge Normgrößen, die beachtet werden müssen, damit es nicht zu Kipppunkten kommt, kurzum: Ist etwas bloß in der Natur Vorfindliches schon gleich ein Normenparameter? Sollten sich danach etwaige Gefühle richten? Mein verstorbener Münchener Lehrer, der Philosoph Robert Spaemann hat da zwischen Naturwüchsigem – bloß Vorkommendem – und Natürlichem unterschieden. Provokativ fragte er gerne: Ist eine Löwenmutter eine gute Mutter, die ihren Kindern nicht das Jagen beibringt? Naturwüchsig gibt es solche Löwenmütter, die das nicht tun, natürlich ist es aber nicht, dass sie ihren Kindern das Jagen nicht beibringen.
Ins Korsett von Heteronormativität gezwungen?
Aber wenn diese Naturvorgaben – naturwüchsige und natürliche – in mich hineinreichen? Da muss ich das eine vom anderen unterscheiden können. Klar, wenn ein großes Blutbild den Ernährungsplan bestimmt, ziehen Geschmäcker, Vorlieben und Gefühle manchmal den Kürzeren. Der Cholesterinspiegel und dessen Normvorgaben an gutem und schlechtem Cholesterin diktiert dem Gesundheitsbewussten den Speiseplan. Bei Heteronormativität – Michael Warner führte den Begriff 1991 ein – findet offenbar eine Revolution gegen das Natürliche in mir statt: Alle Macht den Gefühlen! Da werden halbwüchsigen jungen Mädchen die Brüste amputiert, wenn der Körper nicht zum Gefühl passt. In pathogenen Einzelfällen können hormonelle und chirurgische Maßnahmen durchaus überlegenswert sein, aber nicht im Normalfall entwicklungsbedingter Irritationen, die im Übrigen höchst fluide sein können.
Natur um uns herum und Natur in uns
Also noch einmal von vorne: Was ist normal, wenn die Natur um uns herum vor meinem Innern nicht haltmacht, in mich hineinragt und dich und mich gnadenlos in ein XX- oder XY-Korsett zwängt? Das christliche Menschenbild sollte das Maß abgeben: Binärität kann durchaus auf Bipolarität erweitert werden. Aber der Sachverhalt Bipolarität ist keineswegs begrifflich dazu geeignet, ein buntes Kaleidoskop von Geschlechtlichkeiten zu begründen, nur weil es naturwüchsig vorkommt. Dagegen spricht nicht nur die „Intention“ des Schöpfers in den ersten Genesiskapiteln. Die Anthropologie der Heiligen Schrift ist absolut kongruent mit den finalen Prozessen in der Natur, die Fruchtbarkeit anstreben oder evolutionsgeschichtlich Unfruchtbarkeit in der Regel ausselektieren.
Sehr geehrter Herr Generalvikar, sehr gerne sehe ich Ihrem Widerspruch entgegen. Mit Einstein bin ich nach wie vor der Auffassung, dass Fakten gedeutet werden müssen. Sie aber machen aus Deutungen Fakten. Das halte ich für wissenschaftstheoretisch nicht zulässig.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Müller
Philosoph und Theologe, akademischer Direktor i. R. am Institut für Katholische Theologie der Universität Koblenz. Autor u.a. des Buches „Hineingenommen in die Liebe“