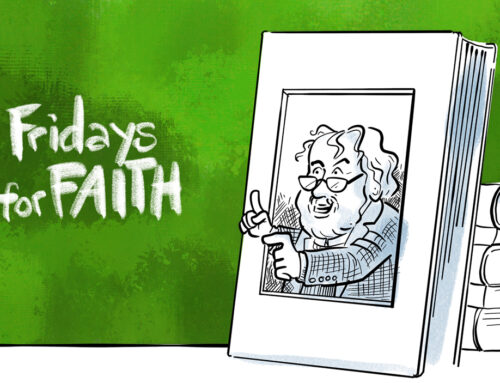Die Volkskirche ist passé, Strategien und Programme gescheitert. Warum die Kirche keine Tankstelle für Menschen ist, die sich nach den alten Zeiten sehnen, zeigt Pater George Elsbett LC auf. Er plädiert dafür, mutig alte Zöpfe abzuschneiden, wenn die Kirche nicht mehr der Vision dient, Menschen für Jesus zu begeistern und sie zu begleiten.
Volkskirche, die es nicht mehr gibt
Wir denken innerkirchlich noch großteils volkskirchlich. Das heißt, wir setzen in der Praxis eine Welt voraus, die es nicht mehr gibt. Christsein ist heute eine Option unter vielen. Optionalisierung nennt es mein Landsmann aus Kanada, der Philosoph Charles Taylor. Allein schon dieser Megatrend hat uns als Kirche paralysiert. Dafür sind wir nicht bereit. Wir erhalten jahrhundertealte Strukturen, Vorgehensweisen und Institutionen, die halt ihren Weg gehen. Diese Institutionen brauchten Manager und Verwalter oder, um es kirchlicher auszudrücken, Hirten. Hirten, die sich um die Schafe kümmern. Sie wurden aber weder ausgebildet noch vorbereitet, um Schafe zu erreichen, die nicht da sind. Nur etwa vier Prozent der Katholiken in Deutschland praktizieren ihren Glauben und feiern die Messe mit; für 96 Prozent hat die Kirche keine Bedeutung mehr, obwohl sie sich noch als katholisch bezeichnen. In Wien liegt der Anteil von praktizierenden jungen Katholiken unter einem Prozent. Wenn wir also nicht lernen, das eine Schaf ruhig grasen zu lassen, um die 99 zu suchen, können wir bald zusperren.
Neue alte kirchliche Großwetterlage
In volkskirchlichen Ländern war in volkskirchlichen Zeiten sogar die Mission nach innen gerichtet: die Volksmission. Die Leute kamen von allein. Es gab keine anderen Optionen, allein die Frage danach wäre absurd gewesen. Es bedurfte keiner Unterscheidung, was zu tun sei, sondern es war klar: Erstkommunionunterricht, katholische Schule, katholische Jungschar, Firmunterricht. Man dachte eher in Programmen denn in Schritten. Denn Menschen auf einem Weg der Jüngerschaft zu begleiten, war weniger notwendig – mit Ausnahme der geistlichen Begleitung –, weil das gesamte Umfeld dazu verholfen hat.
Die Herausforderung hin zu einem Paradigmenwechsel ist auch deswegen so groß, weil man argumentieren könnte, dass wir uns in der westlichen Welt in einer kirchlichen Großwetterlage befinden, wie wir sie seit Konstantin, also seit 1700 Jahren nicht mehr hatten.
Missionarische Pastoral
In dieser Situation möchte ich drei Prioritäten für eine missionarische Pastoral vorschlagen, auch wenn ich mich in diesem Beitrag auf die erste beschränken muss: zur visionären Leiterschaft befähigen, relevante Glaubenserfahrungen ermöglichen, Jüngerschaft konkretisieren.
Eine fundamentale Bemerkung zu Beginn: Das Gebet ist das Fundament, auf dem jegliches pastorales Tun aufbauen muss. Alles, was wir tun, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn der Herr nicht auftaucht. Wirkliche Fruchtbarkeit für das Reich Gottes kann nur dort entstehen, wo gebetet wird. Das gilt auch für jede einzelne der soeben erwähnten Prioritäten.
Die meisten Gemeinden, die zu uns ins „Zentrum Johannes Paul II.“ kommen, um Inspiration und Hilfe zu suchen, haben keine Vision. Sie verstehen oft nicht, wovon wir reden. Sie denken in Fragen „wie schaffen wir es, den Firmkurs zu schmeißen?“ und „wie organisieren wir dieses Jahr den Christkindlmarkt?“ Sie denken volkskirchlich. In einem volkskirchlichen Kontext fokussiert sich die Predigt stark auf die Bekehrung des Verhaltens, weil das Grundnarrativ des Christlichen nicht infrage gestellt wird. Was die Gefahr mit sich bringt, den Glauben auf die Moral zu reduzieren: „Sei ein guter Mensch!“ Ja, fein, aber das sind genügend Atheisten auch.
Wenn in der „Volkskirche“ die Verkündigung stark mit der Moral zusammenhing, so bedarf es heute zuerst des „Vision casting“. Wir müssen lernen, das menschliche Drama und das christliche Narrativ neu zu erzählen. Sonst werden die meisten unserer Aussagen für moderne Ohren keinen Sinn ergeben, absurd oder sogar gefährlich scheinen. Wenn man zum Beispiel die sakramentale Vision nicht versteht, dass wir in einer sichtbaren und in einer unsichtbaren Welt gleichzeitig leben, dass das Sichtbare Träger einer tieferen Botschaft ist, dass die ganze Schöpfung die Geschichte Gottes erzählt, dass sogar das, was ich mit meinem Körper sexuell mache oder wie ich einen Obdachlosen behandle, die Herrlichkeit Gottes aufleuchten lässt oder auch ein Anti-Sakrament, eine Art Sakrileg werden kann, dann brauche ich gar nicht beginnen, über Themen wie Realpräsenz, Sexualmoral, Frauenpriestertum oder Kirche zu sprechen.
Wo wollen wir hin?
Wir brauchen aber Vision noch in einem anderen Sinn. In einer Zeit der Optionalisierung bedarf es einer klaren instiutionellen Vision. Wo wollen wir hin? Die Vision darf und soll auf den Knien erbetet werden. Aber wir brauchen sie. Optionalisierung heißt, Optionen zu haben. Menschen werden sich für unser Angebot entscheiden, wenn sie wissen, wo wir hinwollen und davon überzeugt sind. Eine Vision ist ein Bild von Zukunft, das Begeisterung auslöst. Und da tun wir mit einem verwässerten Anspruch des Evangeliums niemanden einen Gefallen.
Für die Sache des Herrn – weil ich es will
Eine klare Vision bringt mehrere Vorteile: Vision schafft Zugehörigkeit und Eigenverantwortung. Ich bin dabei, weil ich es will, weil es eine gemeinsame Vision gibt, wofür ich mich in Freiheit entschieden habe. Das war zum Beispiel früher unser großer Fehler in Wien: „Wir helfen dem Herrn Pfarrer bei seinem Projekt.“ Es geht aber nicht darum, dass die Laien dem Pfarrer bei seinen Sachen helfen. Es geht um die Sache des Herrn, die zu unserer gemeinsamen Sache geworden ist, wozu wir uns alle entschieden haben. Das heißt auch: neue Befähigung der Laien. Wenn man alles kontrollieren will, wird man nicht zur Leiterschaft befähigen. Wo man Verantwortung zutraut, baut man Leiter auf. Wenn man das nicht tut, dann schafft man ein ungutes Gefälle Priester-Laien, wo der Priester oft unbewusst eine Konsumentenkultur fördert, indem er einer passiven Laienschaft „geistige“ und sonstige „Produkte“ reicht, mit fatalen Folgen.
Um-sich-selbst-Kreisen macht krank
Diese Befähigung der Laien wird missglücken, wenn man das oben erwähnte Meta-Narrativ nicht versteht. Ohne dieses wird es nur um Machtverhältnisse zwischen Laien und Priestern gehen, um eine Verwischung und sogar Verneinung der gegenseitigen Rollen. Statt die Laien zu befähigen, im säkularen Raum das Licht des Evangeliums aufleuchten zu lassen, wird es darum gehen, dass Laien Priester spielen und Priester Laien, um gegenseitige interne Machtspiele, um ein Kreisen um sich selbst. Eine Organisation, die nur um sich selbst kreist und sich nicht erinnert, warum sie eigentlich in der Welt ist und welchen Auftrag sie hat, wird krank.
Spannung zwischen Kirche und Welt
Wenn etwas mit der Vision nicht übereinstimmt, warum macht man es dann? Wenn unsere Kirche den Auftrag „macht Jünger“ hat und das, was wir tun, damit nichts zu tun hat, sollten wir den Mut haben, damit aufzuhören. Visionäre Führung hilft die Spannung auszuhalten: Welt, aber nicht von der Welt. Benedikt XVI. entwickelte die von Romano Guardini aufgenommene Idee der „Spannungseinheit“ weiter. Die Spannung zwischen der Kirche und der modernen Welt muss ausgehalten werden. Der Rückzug in eine getrennte Welt führt zum Verlust der missionarischen Kraft, weil er in der Praxis die Wirklichkeit der Menschwerdung und des realen Wirkens des Auferstandenen im Hier und Jetzt verneint. Er verneint auch die Gebrochenheit der Welt, die Tatsache, dass wir nicht jetzt schon einfach den Himmel bauen können. Glaube hat, wo er gesund war, immer in die Welt der Gegenwart hineingewirkt. Sonst verfällt er in Sektierertum und utopische Vorstellungen, die gewissen neo-marxistischen Strömungen nicht unähnlich sind. Die Kirche darf nicht zu einer Tankstelle für Menschen schrumpfen, die sich nach den alten Zeiten sehnen, sondern muss auf Neuevangelisierung ausgerichtet bleiben.
„Das Sicherste ist ein Schiff im Hafen. Aber dafür ist es nicht gebaut.“ (John Augustus Shedd)
Die Strategie muss der Vision dienen
Strategien werden entwickelt, um eine Vision zu verwirklichen. Es gibt also die Tendenz, dass die Strategien mit der Zeit gar nicht mehr der Vision dienen, sondern dass der Erhalt der Strategie, des Programms oder der Methode zur Vision wird. „Heirate deine Vision, date deine Strategie“ (Andy Stanley). Es darf in unserer Pastoral keine „heiligen Kühe“ geben. Die Kirche wird am Ende der Zeiten noch existieren, unsere Art der Firmvorbereitung oder Jungscharprogramme wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht sollte man das Programm schon vorher zu Grabe tragen.
Gottes Welle surfen
Vision soll aus dem Gebet entstehen und begleitet sein. Man kann keine Welle bauen, aber man kann lernen, sie zu surfen. Jahrelang haben wir in Wien versucht, eine Welle zu bauen, haben Gott gesagt, was er zu segnen hat, anstatt zu schauen, was er gerade segnet und wie wir mitmachen können. Es bedarf des Gebets, um in ein „geistiges Gespräch“ zu kommen, um zu unterscheiden: Welche Wellen baut Gott gerade und wie können wir sie zu surfen lernen? Auch wenn man das nicht verabsolutieren sollte, war es doch im Allgemeinen so, dass in einem volkskirchlichen Zeitalter das Unterscheiden als geistiger Prozess eher auf der persönlichen Ebene betrieben wurde. Es war auf der institutionellen Ebene weniger notwendig, weil klar war, was zu tun ist. Das ist heute grundsätzlich anders. Wir müssen uns ständig fragen, ob das, was wir tun, der Vision, Menschen für Jesus zu begeistern und sie auf einen Weg der Jüngerschaft zu begleiten, überhaupt noch dient.
Pater George Elsbett LC
ist Leiter des „Zentrum Johannes Paul II.“ in Wien. Sein jüngstes Buch, „Reset Church – pastorale Strategien für ein apostolisches Zeitalter“, ist hier erhältlich.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der tagespost.