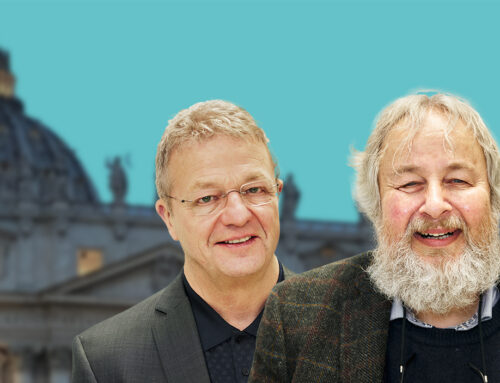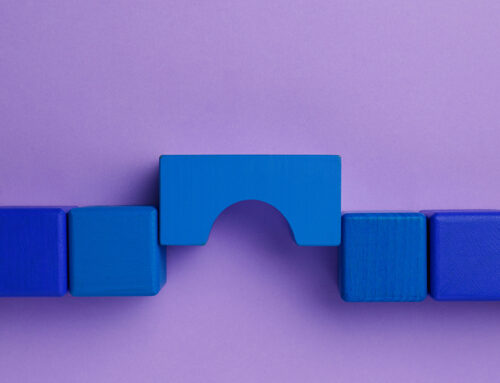Pünktlich zu seinem 20. Todestag greifen deutsche Theologen Papst Johannes Paul II. frontal an. Ihr Missvergnügen gilt nicht nur der “Theologie des Leibes”. Sie wollen eine andere Sexualmoral, Aufwertung der Lust, Anerkennung von Gender, positive Akzeptanz von Homosexualität. Wie ein Granitblock liegt ihrer “neuen Sexualmoral” der große Philosophenpapst Johannes Paul im Weg. Ihn wegzusprengen ist das “Kartell der neuen Sexualmoral” angetreten.
Bernhard Meuser, Autor von “Freie Liebe – Über neue Sexualmoral”, tritt Stephan Goertz und anderen Moraltheologen couragiert und gründlich entgegen.
Wann immer in den letzten Jahren Moralisches in unterschiedlicher Differenziertheit aus den Federn von Eberhard Schockenhoff (+ 2020), Magnus Striet, Christof Breitsameter, Daniel Bogner, Saskia Wendel, Georg Essen, Oliver Wintzek, Martin M. Lintner, Julia Knop oder Stephan Goertz floss, – von Essener Bischöfen amtlich begrüßt und von katholisch.de verkündet wurde – mündete dies in eine konzertierte Kanonade der klassischen Sexualmoral der Katholischen Kirche. Als besonderer Eiferer in diesem „Kartell der neuen Sexualmoral“ hat sich der Mainzer Moraltheologe Stephan Goertz erwiesen. In einem ebenso flapsigen wie prototypischen Beitrag in der Herderkorrespondenz 4/2025 („Gescheiterte Mission – Kritik an der Theologie des Leibes von Johannes Paul II.“) formuliert Goertz den Konsens seiner community:
„Mit einer Theologie des Leibes ist man in der Lage, das von der katholischen Lehre fernzuhalten, was sie seit gut 200 Jahren kulturell in Bedrängnis bringt.“
Indem Goertz die „TdL“ (kürzen wir sie in der Folge so ab) einer vernichtenden Kritik unterzieht, trifft er nicht nur einen bestimmten moraltheologischen Ansatz. Er trifft pünktlich zum 20. Jahrestag seines Todes die Person Johannes Paul und das, wofür sie steht: die Fortentwicklung der kontinuierlichen kirchlichen Lehre von Sexualität, Liebe und Ehe in gleich drei großen Werken, die untrennbar mit ihm verbunden sind:
a) die „Theologie des Leibes“,
b) der „Katechismus der Katholischen Kirche“ (1992)
c) die Enzyklika „Veritatis splendor“ (1993).
Warum ist es berechtigt, von einem „Kartell“ zu sprechen?
Ein Kartell ist eine Preisabsprache unter Wettbewerbern. Die genannten Theologen waren oder sind untereinander verbunden. Sie halten die kirchliche Lehre in vieler Hinsicht für nicht mehr zeitgemäß und möchten, Kundenwünschen folgend und durch Verbilligung der Ware, den Anschluss an „die Moderne“ herstellen – was immer das sein mag. Der von der Kirche emanzipierte Blick auf die allgemeine Moralität kommt freilich noch immer von unten, – aus der Scham der Minderwertigen, vom Underdog-Komplex einer nicht mitgekommenen katholischen Welt. Dort, wo der kirchliche Zeigefinger früher die „böse Welt“ bekämpfte, regiert jetzt Wertschätzung. Scheinbar wertneutral nimmt man zur Kenntnis, dass sich die Allgemeinheit von „früheren gesellschaftlichen Beschränkungen und Einbindungen“ losgesagt hat. „Das Begehren und die Lust beginnen, die Sexualität zu legitimieren. Liebe und Sexualität finden nicht automatisch zueinander, wenn sie es denn je getan haben. Eine moderne Gesellschaft ist zudem nicht länger angewiesen auf eine Sexualmoral, deren Normen sich den Anforderungen einer Standesgesellschaft oder der «wahren Natur der Sexualität» verdanken.“ (S.G. in einem Aufsatz von 2014 über Jugendsexualität)
Überall schimmert bei ihm, wie bei anderen moraltheologisch Anschlusssuchenden, ein fröhliches „Gut so!“ durch. Langsam, kaum merklich, schleicht man sich in Auffassungen hinüber, wie sie etwa mit dem Namen Helmut Kentler (1928-2008) – erst “Papst der Sexualwissenschaft”, dann “Schlüsselfigur pädosexueller Netzwerke” – verbunden sind. Die Natur der Sexualität wird von der personalen Bindung gelöst. Im Kult des Begehrens dringt die in der “alten Moral” viel geschmähte Natur durch die Hintertür wieder in die “neue Moral” ein.
Gibt es weitere Übereinkünfte im Kartell der neuen Sexualmoral?
Hier sind folgende, scheinbar disparate Stichworte zu nennen: Durchgängig findet man den neuen ethischen Ausgangspunkt in einer gewissen Normativität der „Lebenswirklichkeit heute“ (so die standardisierte Redeweise auf dem deutschen Synodalen Weg) und in angeblichen Fortschritten der Humanwissenschaften zum sexuellen Wissen. Man rekurriert auf die Vulnerabilität, die ein leib- und sexualfeindliches Denken bei Betroffenen auslöst, wobei die klassische Sexualmoral unter die wesentlichen Auslöser dieser Verletzungen gerechnet wird. Man nimmt typischerweise starken Bezug auf Immanuel Kant (1724-1804), in dessen Denken über Freiheit und Autonomie man fälschlicherweise die Ermächtigung des Subjekts erkennt, sich selbst das Gesetz des Handelns zu geben. Auffällig ist die Ferne dieser Denkschule zur Heiligen Schrift (sie wird – nicht überall, aber in der Regel – sekundär beigezogen oder ihres Weisungscharakters entkleidet). Auffällig ist die durchgängige Sympathie für Gender, wobei vor allem die voluntaristische Auffassung rezipiert wird, der Mensch sei wesen- und naturlos, er könne sich frei „überschreiben“ und sei in der Lage, sich bis in seine geschlechtliche Identität hinein selbst zu definieren. Die Denkschule operiert vornehmlich mit sogenannter „Beziehungsethik“, die in vereinseitigten Formen bei der Tautologie gelebten Lebens landet. Im Horizont endlich erkannter Befreiung von „Wesen“ und „Weisung“, ist „Beziehung“ alles. Hauptsache Liebe! Ein weiter auffälliger Faden in der kollektiven Absage an die klassische katholische Sexualmoral ist eine gewisse Fokussierung auf das Thema Homosexualität, sei es, weil uns die skeptische Haltung „seit gut 200 Jahren kulturell in Bedrängnis bringt“, sei es um eine moraltheologische Lücke zu füllen, sei es um betroffenen Menschen oder sich selbst gerecht zu werden.
Tatsächlich ist gleichgeschlechtlicher Sex im christlichen Konzept von Liebe und Ehe bislang weithin ortlos. Als Gestalt von Liebe und Sex – so die offizielle Lehre – widerspricht er der Natur der ehelichen Liebe; die Heilige Schrift kennzeichnet ihn als „schlimme Abirrung“ (KKK 2357). Neben dem dringenden Wunsch, endlich auch auf den Zug der Moderne aufzuspringen, ist die notorisch erhobene Forderung, gleichgeschlechtliche Liebe ohne Wenn und Aber in den Adelsstand der Gottgefälligkeit zu erheben, wahrscheinlich der hintergründig bohrende, zweite große Treiber der „neuen Sexualmoral“. Das würde den Nachdruck plausibel machen, mit dem „Natur“ und „Naturrecht“ bekämpft, die Heilige Schrift gefiltert und oft gegen den Wortsinn interpretiert, und die Identität durch „Autonomie“ auf die Spitze (ja sogar gegen Gott) getrieben wird.
Warum ist ausgerechnet Johannes Paul II. der große Feind?
Im Blick auf die katholische Theologie überhaupt, nimmt die Gruppe der genannten Theologen eine Außenseiterstellung ein. Das moraltheologische Ressentiment gegen Rom und gegen den Papst, dessen Kernanliegen die christliche Ethik war, ist ein im Wesentlichen deutsches Phänomen. Weltweit hat man den Neuansatz einer tugendorientierten Moraltheologie, wie er von einem der bedeutendsten, an Kant und Scheler geschulten Ethiker des 20. Jahrhunderts – Karol Józef Wojtyła nämlich – vorgetragen wurde, durch die Bank freudig begrüßt. „Liebe und Verantwortung“ – sein großer phänomenologischer Wurf – erschien bereits 1960. Das Buch stellt den Rohbau des Hauses dar, das Johannes Paul dann während seines Pontifikats bis in den letzten Winkel ausbaute. Als Papst stemmte sich Karol Wojtyła sogleich und mit Wucht gegen einen moraltheologischen Neuansatz, der vor allem mit den Namen Bruno Schüller SJ, sowie Franz Böckle und dem Aufreger-Buch von Alfons Auer „Autonome Moral und christlicher Glaube“ (1971) verbunden war und im Kern schon die heutige Krise vorwegnahm.
Inhaltlich ging es diesen Neuerern schon damals um die Herauslösung der Moral aus einer zu engen Bindung an die Offenbarung, aus dem Naturrecht und dem „natürlichen Sittengesetz“ zugunsten einer umfassenden Souveränität der Vernunft in Hinsicht auf die sittlichen Normen. Johannes Paul sah darin eine fatale Relativierung ihrer Geltung. Seine Sorge mündete in einer Enzyklika, die 1993 unter dem Namen „Veritatis splendor“ erscheinen sollte. Papst Benedikt überlieferte dazu 2019 eine rebellisch klingende Bemerkung von Franz Böckle, der Wind von der Sache bekommen hatte:
„Wenn die Enzyklika entscheiden sollte, dass es Handlungen gäbe, die immer und unter allen Umständen als schlecht einzustufen seien, wolle er dagegen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften seine Stimme erheben.“
Benedikt konnte sich einen Zusatz nicht verkneifen:
„Der gütige Gott hat ihm die Ausführung dieses Entschlusses erspart; Böckle starb am 8. Juli 1991. Die Enzyklika wurde am 6. August 1993 veröffentlicht und enthielt in der Tat die Entscheidung, dass es Handlungen gäbe, die nie gut werden können.“
Die Enzyklika „Veritatis splendor”
Während international die Majorität der Moraltheologen in der Enzyklika ein nach vorne weisendes Meisterstück der Fundamentalmoral und die Roadmap vernünftiger, an Schrift, Tradition und sehender Wahrnehmung der Wirklichkeit orientierter Moral erkannte, ist „Veritatis splendor“ bis auf den heutigen Tag der Stachel im Fleisch der einschlägigen Community von Böckle bis Striet. Um Stephan Goertz aus dem Kontext heraus zu verstehen, müssen wir „Veritatis splendor“ schlaglichtartig mit dem kontrastieren, worum es ihm und seiner Community geht. Schauen wir in den Text!
Die Enzyklika – mit ihr christliche Ethik, wie Johannes Paul sie versteht – beginnt demonstrativ mit Heiliger Schrift, nämlich mit der Frage: „Meister, was muss ich Gutes tun?“ (Mt 19,16). Das Wort Gottes steht am Anfang, will ganz ernst genommen werden, verweigert sich der sekundären Verarbeitung als Zitatenschatz und Belegquelle für außertheologisch generierte ethische Annahmen. Die Schrift selbst stellt die moralische Grundfrage aller Zeiten und aller Kulturen in lapidarer Kürze. Und sie adressiert sie theo-logisch an den Richtigen, – an den, der es wissen muss: Christus. Durch ihn werden Erkenntnis und Existenz kurzgeschlossen. Der Meister fordert den jungen Mann, der sich entschlossen in Richtung des Guten aufgemacht hat, ihm zu folgen.
Der organische Umgang mit Heiliger Schrift – die Enzyklika „atmet“ sie buchstäblich von Zeile eins an – steht in starkem Kontrast zu den philosophisch grundierten Traktaten anthropozentrisch orientierter Moraltheologie, ihrem utilitaristischen Umgang mit der Heiligen Schrift und dem elaborierten Instrumentarium, mit dem man das Wort Gottes an brenzligen Stellen auf Distanz hält: durch Relativieren, Verschweigen, Übergehen, Historisieren, Befreien von Folgen, Entkernen, Zurückführen auf Bekanntes, Eliminieren, Selektieren, Interpretieren. Was bleibt, soll pragmatisch passen zur prioritären Würde souverän gesetzter Lebensentwürfe. „Das Wort sie sollen lassen stahn!“, würde Martin Luther einwenden.
Das zweite Kapitel von „Veritatis splendor” eröffnet mit einer neuen Störung. Wieder gibt ein Schriftzitat die Richtung vor; diesmal ist es ein Imperativ: Gleicht euch nicht der Denkweise dieser Welt an! (Röm 12, 2) In Christus ereignet sich „neue Schöpfung“ (1 Kor 5,17). Christus in Person ist die Renovation der göttlichen Urordnung; durch ihn hält auch eine neue, kontrastierende Denkweise Einzug in die Routinen unseres Denkens. Sie orientiert den moraltheologischen Diskurs wieder an dem, „was der Wille Gottes ist: was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist.“ In dieser Linie ist es nicht Aufgabe des Lehramtes, „den Gläubigen ein besonderes theologisches und schon gar nicht ein philosophisches System aufzuerlegen.“ Wohl aber muss die lehrende, vom Heiligen Geist in der Wahrheit gehaltene Kirche die „gesunde Lehre“ (2 Tim 4,3) verteidigen, insbesondere angesichts jener „Elemente der Sittenlehre der Kirche, die heute besonders dem Irrtum, der Zweideutigkeit oder dem Vergessen ausgesetzt zu sein scheinen.“
Die „neue Sexualmoral“ dürfte sich in Pkt. 32 gemeint fühlen: „So ist man in manchen modernen Denkströmungen so weit gegangen, die Freiheit derart zu verherrlichen, dass man sie zu einem Absolutum machte, das die Quelle aller Werte wäre.“ In immer neuen verfänglichen Varianten kreisen die genannten Theologen um einen Freiheitsbegriff, der sich emanzipiert von jeder Norm setzenden Instanz außerhalb der Freiheit des Subjekts. „Selbst zu denken“, sagt Striet, „… ist die normative Anweisung, die in ihr steckt.“ Könnte sich hinter der nebulösen Formulierung die „Denkweise dieser Welt“ verstecken? In der Freiheit steckt gerade nicht schon die Norm. „Es sind dies“, so Veritatis splendor 34, „Tendenzen, die in ihrer Verschiedenheit darin übereinstimmen, die Abhängigkeit der Freiheit von der Wahrheit abzuschwächen oder sogar zu leugnen.“ Ausdrücklich wird vor einem „falschen Begriff der Autonomie der irdischen Wirklichkeiten“ gewarnt, „einem solchen nämlich, der meint, dass »die geschaffenen Dinge nicht von Gott abhängen und der Mensch sie ohne Bezug auf den Schöpfer gebrauchen könne«“. Auch die Freiheit ist geschaffen; sie ist keine kreative Instanz neben Gott, kann nicht als eine Kolonie des Menschlichen ohne Zutrittsberechtigung für Gott gedacht werden. Freiheit als reiner Selbstbezug und ohne gewissenhaften Bezug auf Gott nimmt, wie jede Überdehnung der Autonomie, „schlussendlich atheistischen Charakter an.“ Im Resultat landen wir nicht nur bei einer schriftfernen, sondern gottfernen, pelagianischen Ethik: als könnten wir uns in der Freiheit selbst erlösen …
Auch das dritte Kapitel macht an einem Schriftzitat fest: „Damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird (1 Kor 1, 17).“ Johannes Paul II. schärft den Bischöfen – an sie ist die Enzyklika gerichtet – ein, auf eine Moraltheologie zu achten, in der es notwendig Freiheit gibt, freilich „Freiheit, die sich der Wahrheit unterwirft.“ Allein zu dieser Freiheit „hat uns Christus befreit.“ (Gal 5,1) In dem hybriden Anspruch, individuell und „autonom zu entscheiden, was gut und was böse ist“, manifestiert sich zuletzt Unglaube, „Misstrauen in die Weisheit Gottes, die den Menschen durch das Sittengesetz leitet. Den Geboten des Sittengesetzes stellt man die sogenannten konkreten Situationen entgegen, weil man im Grunde nicht mehr daran festhält, dass das Gesetz Gottes immer das einzige wahre Gut des Menschen ist.“ (Pkt. 84) Johannes Paul II. erinnert die Kirche an „ihr pädagogisches »Geheimnis«, … dass sie den Blick unverwandt auf den Herrn Jesus richtet … da sie sich völlig bewusst ist, dass allein bei ihm die wahre und endgültige Antwort auf die sittlichen Fragestellungen liegt.“ Ethische Umwege um Christus herum zu bauen, bringt letztlich das Kreuz um seine Kraft (1 Kor 1,17). „Der gekreuzigte Christus offenbart den authentischen Sinn der Freiheit, er lebt ihn in der Fülle seiner totalen Selbsthingabe und beruft die Jünger, an dieser seiner Freiheit teilzuhaben.“ (Pkt. 85)
Eine Moraltheologie, die sich mit gleicher Gründlichkeit von der Natur, der Offenbarung und dem telos (Ziel) gegengeschlechtlicher Liebe lossagt und nur noch den Trieb und die Kausalmechanik des „ganzheitlichen Begehrens einer anderen Person“ gelten lassen will, dabei in Kauf nimmt, dass sie „sich nicht kalkulieren oder erzwingen, nicht durch bloßen Willen am Leben erhalten, nicht institutionell einfangen“, lässt, „sich womöglich nicht um die Geschlechterdifferenz oder die Differenz des Lebenstandes“ schert, „sich durch sich selbst“ (Stephan Goertz) legitimiert, – eine solche Moraltheologie wanzt sich heran an die falschen Verhältnisse und merkt nicht, wie sie sich selbst erübrigt. Niemand braucht sie, wie niemand eine Kirche braucht, die nicht mehr das Evangelium proklamiert. In der Perspektive von „Veritatis splendor“ hat sie selbst Anteil an der „trostlosen Ratlosigkeit“ des Menschen, „der häufig nicht mehr weiß, wer er ist, woher er kommt und wohin er geht.“ Und so begleitet sie nur nichtssagend „das erschreckende Abgleiten der menschlichen Person in Situationen einer fortschreitenden Selbstzerstörung.“ (Pkt. 84) Der Mensch ist eben kein „wesenloses Freiheitsatom“ (Engelbert Recktenwald), sondern – wie immer er sich fühlt – mindestens einmal Mann oder Frau, Vater oder Mutter. Seine Würde existiert vor und jenseits der sich selbst Norm gebenden Freiheit unbeschrifteter Subjekte.
Weitere Teile:
Bernhard Meuser
Jahrgang 1953, ist Theologe, Publizist und renommierter Autor zahlreicher Bestseller (u.a. „Christ sein für Einsteiger“, „Beten, eine Sehnsucht“, „Sternstunden“). Er war Initiator und Mitautor des 2011 erschienenen Jugendkatechismus „Youcat“. In seinem Buch „Freie Liebe – Über neue Sexualmoral“ (Fontis Verlag 2020), formuliert er Ecksteine für eine wirklich erneuerte Sexualmoral. Bernhard Meuser ist Mitherausgeber des Buches “Urworte des Evangeliums”.
Beitragsbild: Papst Johannes Paul II, Anfang/Mitte der Neunziger Jahre. Quelle: Alamy Bildagentur