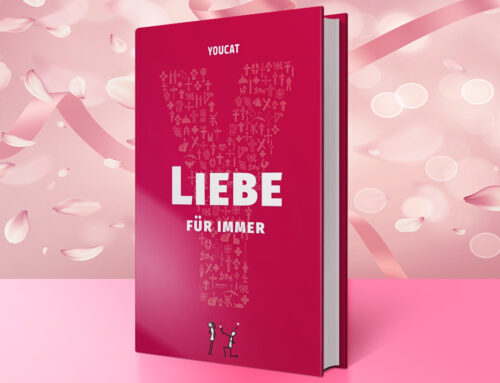Als Fastenserie posten wir jeden Freitag die Auslegung des Sonntagsevangeliums durch Dr. Martin Brüske.
Nicht gekommen, um zu richten:
Jesus und die Ehebrecherin.
Auslegung des Evangeliums vom 5. Fastensonntag C Jo 8, 1-11
Der einzige, der zu richten berechtigt ist, verzichtet frei und souverän darauf. Das ist Gnade, die den neuen Anfang schenkt. Jesus befreit aus Todesangst und Scham. Die selbsternannten Ankläger wirft er auf sich selbst zurück. Er lässt sie ihre eigene Sünde entdecken. Auch das ist Gnade. Für alle gilt: „Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!“
Eine fremde Perle im Diadem des Johannes
Manche kostbare Perle authentischer Jesusüberlieferung hat in frühester Zeit keinen Eingang in die später von der Kirche anerkannten „kanonischen“ Evangelien gefunden. Eine solche Perle ist auch unser Evangelium. In der frühesten Textüberlieferung des Johannes findet es sich nicht. In vielen Merkmalen passt diese Geschichte viel besser zu Matthäus, Markus oder Lukas. Zum Beispiel kommen im ganzen Johannesevangelium sonst keine Schriftgelehrten vor. Die kennen wir aber in Kombination mit den Pharisäern aus den drei ersten Evangelien… Am besten würde unser Evangelium zu Lukas passen und dann dort in die letzte Woche in Jerusalem, nach dem Einzug, von dem wir bald, am Palmsonntag, wieder hören. Wahrscheinlich ist es aber in judenchristlichen Kreisen überliefert worden. Hieronymus, Ambrosius und Augustinus haben sich für seine Zugehörigkeit zur Heiligen Schrift eingesetzt. Hieronymus hat es in seine Übersetzung, die Vulgata, aufgenommen. Und das Konzil von Trient hat mit der Vulgata die Grenzen der Heiligen Schrift festgelegt. So gehört es einfach dazu. Und es würde wirklich eine Perle fehlen, wenn dieses Evangelium fehlte. Finden Sie nicht?
Und der Juwelier, der irgendwann die fremde Perle in das Diadem des Johannesevangeliums eingearbeitet hat, damit sie nicht verloren geht, hat sich dabei überhaupt recht geschickt angestellt. Nur wenn man ganz genau hinschaut, merkt man die feinen Nähte. Aber viel wichtiger ist, dass unser geistlicher Juwelier sich etwas dabei gedacht hat, als er die Perle einsetzte. Deshalb habe ich Ihnen die Textgeschichte unseres Evangeliums überhaupt erzählt. Denn die fremde Perle bekommt, eingesetzt in das Diadem des Johannes, noch einmal einen ganz eigenen Schimmer.
Mir ist zum einen eine Parallele aufgefallen. So etwas verstärkt dann die Aussage. In der Erzählung von dem Gelähmten am Teich von Betesda heißt es am Ende: „Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden; sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre.“ (5,14). Auch hier hat Jesus in einem aussichtslosen Fall einen neuen Anfang geschenkt – und auch hier verbindet er das mit der Aufforderung, nicht mehr zu sündigen, die geschenkte Befreiung aus 38 Jahren Krankheit also zu nutzen, um das Leben wirklich neu auszurichten. Verbunden ist das an dieser Stelle mit einer Warnung, die uns an das Evangelium vom dritten Fastensonntag (C) erinnert.
Noch wichtiger ist aber eine andere, ganz grundsätzliche Aussage Jesu im Johannesevangelium, die in der fremden Perle der Geschichte von der Ehebrecherin plötzlich ganz anschaulich wird. Jesus sagt von sich bei Johannes, dass ihm das ganze Gericht übergeben ist: „Denn der Vater richtet niemanden, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben.“ (5, 22). Das heißt für Johannes: Am Menschensohn gerät die von Gott abgewendete Welt, die Finsternis, in die Krise. Ihr endgültiges Schicksal entscheidet sich gegenüber dem, der das Licht der Welt, die Wahrheit und das Leben ist. Jesus, der menschgewordene Sohn, ist also auch der Richter der Welt. Aber er ist zugleich ein wahrlich seltsamer Richter. Zuerst wird ja gesagt: „Der Vater richtet niemanden“. Aber der, dem er das Gericht übergeben hat, der sagt von sich, dass er auch nicht richtet: „Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht; denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter: Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am Jüngsten Tage.“ (12, 47f). Jesus ist der Richter, der nicht richtet. Der Richter, dem das Gericht übergeben ist, der aber gekommen ist, um zu retten. Und dessen Wort dennoch so viel alles bestimmendes Wirklichkeitsgewicht hat, dass sich das ewige Schicksal des Menschen an der Stellungnahme zu diesem Wort entscheidet. Unser geistlicher Juwelier hat gesehen, wie wunderbar das passt: Der Richter, der nicht richtet, sondern rettet – das ist der Schlüssel zu unserem Evangelium. Sehen wir also hin!
Es riecht nach Lynchjustiz
Nach der auf dem Ölberg (man darf ergänzen: bei Freunden) verbrachten Nacht kommt Jesus wieder in den Tempel, um zu lehren. Nach dieser sehr knappen Situationsangabe nimmt die Szene plötzlich eine dramatische Wendung: Jesus hat sich als jüdischer Lehrer hingesetzt, das Volk ist um ihn versammelt und will ihn hören – da taucht eine Schar Pharisäer und Schriftgelehrter auf, die eine Frau vor sich hertreibt. Man spürt förmlich die Aufregung und Hysterie, ja die drängende Gewaltsamkeit des Vorgangs. Sie stellen die Frau in die Mitte und stellen sie als auf frischer Tat ertappte Ehebrecherin vor. Ohne auch nur einen Augenblick der Besinnung, führen sie die Tora des Mose an, die die Todesstrafe für Ehebruch vorsieht und versuchen Jesus zur Stellungnahme zu nötigen. Sie wollen Zeugen, Ankläger und Richter zugleich sein. Denn im Grunde nehmen sie den Ausgang vorweg: Es kann eigentlich nur auf Hinrichtung durch Steinigung hinauslaufen. Bei Licht besehen: auf Lynchjustiz. Denn die Römer haben den Juden zwar wesentliche Teile ihrer Selbstverwaltung gelassen, aber das ius gladii, das Schwertrecht, das Recht, die Todesstrafe bei Kapitalvergehen zu verhängen, haben sie ihnen genommen. Und ebensowenig wäre das, was hier vorgeht, ein ordentliches Verfahren nach jüdischem Prozessrecht. Sie suggerieren aber die vollkommene Eindeutigkeit der Situation. Die Sache scheint völlig klar. Man hat die Frau doch in flagranti erwischt! Die Zeugen dafür sind sie selbst. Was die Tora vorsieht, was also Gott will, scheint ebenso klar zu sein. Ihre Frage an Jesus „Was sagst du dazu?“ ist damit alles andere als eine offene Frage. Die vermeintlich völlige Eindeutigkeit der Situation soll Jesus zu einer Antwort zwingen, die, wie auch immer er antwortet, für ihn verhängnisvoll ist…
Aber bevor wir hier weitergehen: Vergessen wir die namenlos bleibende Frau nicht! Man hat sie in die Mitte gezerrt. Auch wenn die Erzählweise des Textes innere Vorgänge nicht benennt, sind sie gegenwärtig! So wie die aufgeregte Hysterie ihrer Ankläger spürbar ist, so ist auch die Todesangst und die Scham spürbar, die die Frau erfüllt hat. Dort, in der Mitte, weiß sie nicht, wohin sie ihren Blick wenden soll. Sie schaut zu Boden. Vielleicht ist sie dort völlig erstarrt, wie festgebannt, und zugleich zittert ihr Körper in ihrer Scham und in ihrer Todesangst. Ihre ganze Existenz wird zum Instrument und Objekt gemacht. Denn ihren Anklägern geht es zuletzt ja nicht um die Gerechtigkeit der Tora. Wie das dort vorgesehene Strafrecht für Kapitalvergehen zu handhaben ist, wird übrigens damals unter den Rabbinen intensiv diskutiert. Und die Tendenz ist sehr klar: Den Vollzug der Todesstrafe so weit wie möglich durch Bedingungen und Unterscheidung der Fälle reduzieren! Man nennt das Kasuistik. Auch das gehört zu den Hintergründen unseres Evangeliums. Kasuistik bräuchte aber Aufmerksamkeit für den Fall, nicht Schnelljustiz. Hier geschieht das Gegenteil: Scheinbare Eindeutigkeit soll benutzt werden, um Jesus zu einer Antwort zu nötigen, die ihn – so oder so – unmöglich macht. Ein gefallener Mensch ist das willkommene Instrument dazu: Die Frau wird vorgeführt, um Jesus vorzuführen! Dass auch ein gefallener Mensch eine Würde hat, ist ihren Anklägern egal. Und man sage nun nicht, dass es damals einfach unmöglich war, eine solche Entwürdigung zu sehen. Natürlich hat die Entdeckung der Personwürde aus jüdisch-christlichen Wurzeln auch unsere durchschnittlichen kulturellen Sensibilitäten verändert. Gott sei Dank! Inzwischen sind sie wieder hoch gefährdet! Aber auch damals war solche Feinfühligkeit möglich. Man vergleiche einfach, wie Josef auf die für ihn zwingenden Verdacht erregende Schwangerschaft Marias reagiert. Matthäus charakterisiert ihn in seiner Kindheitsgeschichte deshalb ausdrücklich als „gerecht“ und damit als torafromm…
Jesus und die Tora
Die Ehebrecherin wird also vorgeführt, um Jesus vorzuführen. Die Gegner Jesu meinen, Jesus zu einer Stellungnahme zwingen zu können. Und sie meinen: Die Antwort wird immer falsch sein, was immer Jesus sagen wird… Die perfekte Falle! Denn wenn Jesus sich auf ihre Seite stellt und ihre Interpretation der Tora anerkennt, die sie für die einzig richtige und mögliche halten, dann verrät Jesus seine barmherzige Zuwendung zu den Sündern. Gerade die ist ihnen ja der große Skandal! Und sie wäre als Schein erwiesen: Im Ernstfall des Ehebruchs muss Jesus seine Haltung aufgeben! Dann wäre öffentlich klar, dass an diesem Rabbi mit seiner vermeintlich neuen Botschaft, die so viele anzieht, letztlich „nichts dran“ ist. Oder sie überführen ihn der Gesetzesübertretung: Wenn er sich gegen sie stellt, dann verrät er die Tora, die Weisung Gottes, von dem Jesus behauptet, er sei in einzigartiger Weise sein Vater. Dann ist er als Frevler überführt. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit scheinen hier in unlösbarem Konflikt zu liegen. Dass es allerdings mit der Gerechtigkeit der Gegner Jesu nicht sehr weit her ist, haben wir schon gesehen. Für die Sackgasse, in der wir im Konflikt von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu geraten scheinen, kann es aber nur eine göttliche Lösung geben!
Jesus schreibt in den Staub
Diese göttliche Lösung beginnt damit, dass Jesus die nötigende Hysterie seiner Gegner, die Dynamik ihres Drängens einfach ins Leere laufen lässt. Er reagiert, indem er die erwartete Reaktion schlicht verweigert. Er spricht das nicht aus. Er sagt zunächst einfach nichts, wendet sich ab – und schreibt mit dem Finger in den Staub. So unterbricht er die scheinbar unausweichliche Dynamik. Er lässt sie abprallen. Sie stehen verblüfft da. Das Vakuum, das so einen Augenblick lang entsteht, füllen die Gegner allerdings sofort wieder. Er kann sich nicht in einen Raum neuer Möglichkeit verwandeln: Das lassen sie sich nicht gefallen, dass Jesus sich entziehen will, indem er schweigt. „Rabbi, Du kannst nicht ausweichen, alle Welt wird sagen Du hast Dich gedrückt, Du musst antworten: Der Fall ist eindeutig! Schweigst Du, wirst Du unglaubwürdig!“
Schon jetzt hat die Situation also eine erste Wendung genommen. Jesus hat die Zwangsläufigkeit des weiteren Ablaufs aufgebrochen. Seine Gegner versuchen aber noch, die Situation wieder in ihre Richtung zu drehen. Sie reden auf Jesus ein.
Erst jetzt spricht Jesus. Aber sein Wort ist ebenso souverän wie überraschend. Es strahlt seinerseits eine unausweichliche Autorität aus, die schlechterdings nicht zur Diskussion steht. Ein Felsenwort, an dem sich die Welle der gewalttätigen Hysterie definitiv bricht: „Wer von euch ohne Sünde ist, hebe den ersten Stein“. Jesus nimmt nicht Stellung zu dem eindeutigen Fall, sondern er nennt eine Bedingung des Vollzugs des Urteils. Damit wirft er die Gegner und alle Anwesenden auf sich selbst zurück. Und dann schreibt er wieder in den Staub. Spätestens jetzt wird das sehr geheimnisvoll: Was bedeutet das, haben sich die Umstehenden gefragt und fragt sich auch Leser- und Hörerschaft des Evangeliums heute. Jetzt entsteht aus dem Moment des kurzen Vakuums ein Raum der Besinnung und neuer Möglichkeiten. Hat Jesus hier tatsächlich etwas Bestimmtes geschrieben? Das ist wohl nie endgültig zu klären. Eine offene Stelle. Viel ist darüber diskutiert worden. Die Offenheit sagt aber auch: Finde es! Assoziiere! Suche und bring es in Verbindung mit dem, was ich gesagt habe. Die Gegner Jesu sind ja hochgradig schriftgelehrt. Und so kann man sich vielleicht doch vorstellen, was ihnen – durch Jesu Wort auf sich selbst zurückgeworfen – in kürzester Zeit durch den Kopf geschossen ist. Ja, und deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir bei Jeremia fündig werden: „Denn du, HERR, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zuschanden werden, und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden; denn sie verlassen den HERRN, die Quelle des lebendigen Wassers.“ (Jer 17, 13). Andere haben gesagt, Jesus schreibe hier die Sünden der Umstehenden auf. Sachlich ist da kein großer Unterschied. Und dazu passt auch eine weitere Assoziation einer Schriftstelle: Man kann auch an die schreibende Hand aus dem Danielbuch denken: Menetekel! Jedesmal geht es um untrügliches göttliches Gericht. In Jesu Schreiben erscheint der göttliche Richter selbst!
Im Licht der Bedingung des Urteilsvollzugs und des geheimnisvollen Schreibens des göttlichen Richters in den Staub wird klar: Jeder der hier verurteilt, jeder der hier einen Stein wirft, verurteilt sich selbst und er trifft sich selbst. Und einer nach dem anderen geht – und erklärt sich damit beschämt für unzuständig! Die Ältesten zuerst (hier wohl wirklich: dem Lebensalter nach). An dieser Stelle wird klar: Alle sind Sünder, alle sind verloren, alle bedürfen der Umkehr und der Rettung. Alle Unterschiede – auch die, die die Notwendigkeit menschlicher Rechtsfindung betreffen – sind vor Gott nur relative Unterschiede. Übrigens hat Jesus die Tora des Ehebruchs ja tatsächlich ausgeweitet: Er führt den Ehebruch auf das chaotische Begehren des menschlichen Herzens zurück und die Möglichkeit der Scheidung widerspricht in seiner Verkündigung dem Sinn der Tora im ursprünglichen Willen des Schöpfers. So stehen am Ende alle vor der Wirklichkeit ihrer eigenen Sünde. Außer einem, der deshalb allein in einem letzten, göttlichen Sinn Richter sein kann, weil er allein vollkommen wahr und ohne Sünde ist.
Die Elende und die Barmherzigkeit
„Relicti sunt duo, misera et misericordia“. „Zwei blieben zurück, die Elende und die Barmherzigkeit“. So hinreißend hat Augustinus in seinem Johanneskommentar die Situation am Ende unseres Evangeliums umschrieben und unnachahmlich schön auf den Punkt gebracht. Still ist es geworden. Die auf Gewalt drängende Hysterie ist vorbei. „Hat dich niemand verurteilt?“ „Niemand, Herr.“ „Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.“ Der einzige Richter, der das Recht hätte zu richten: Er richtet nicht. Denn er ist gekommen, um zu retten. Er gibt in vollkommener Souveränität frei. Er befreit aus Todesangst und Scham. Er gewährt den neuen Anfang. Die Freigabe ist übrigens kein Freispruch. Die Sünde ist Sünde. Jesus sagt buchstäblich kein Wort gegen die Tora. Auch das Gewicht dieser Sünde relativiert er nicht. Dies alles wären Missverständnisse ohne Anhalt im Text. Vielmehr: Der göttliche Richter und Retter ist frei, Gnade zu gewähren. Er will das neue Leben vor ihm und mit ihm und in ihm, weil er sein Geschöpf liebt. Aber gerade deshalb will er es in Heiligkeit und Wahrheit. Und so sagt er uns allen: „Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.“
Dr. theol. Martin Brüske
Martin Brüske, Dr. theol., geb. 1964 im Rheinland, Studium der Theologie und Philosophie in Bonn, Jerusalem und München. Lange Lehrtätigkeit in Dogmatik und theologischer Propädeutik in Freiburg / Schweiz. Unterrichtet jetzt Ethik am TDS Aarau. Martin Brüske ist Mitherausgeber des Buches “Urworte des Evangeliums”.
Weitere Beiträge aus der Serie Fridays for FAITH:
Evangelium des ersten Fastensonntags
Evangelium des zweiten Fastensonntags