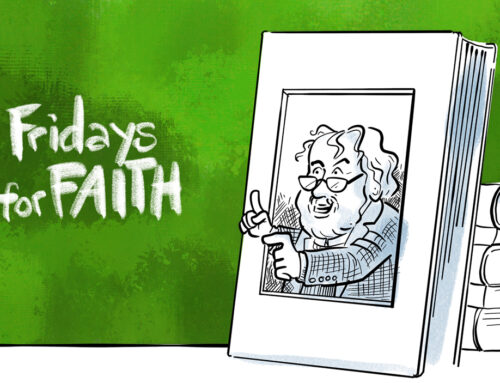Aber, wie und wovon sind wir erlöst worden? Ist es nicht wie bei Sysiphos in der griechischen Sage, in der der Stein immer wieder zurückrollt, wenn nach Ostern der Alltag wieder beginnt. Das fragen sich viele, nicht nur unser Autor Helmut Müller an den Kar- und Ostertagen, wenn es schon im ältesten Evangelium heißt: „Arme werdet ihr immer unter euch haben“ (Mk 14,7). Schon Paulus gibt die Antwort: Auf Hoffnung hin sind wir erlöst (Röm 8, 24).
Für wen oder was ist der Mann aus Nazareth am Kreuz gestorben?
„Arme werdet ihr immer unter euch haben“ (Mk 14,7) Diese Worte des Mk-Evangeliums, aus dem Zusammenhang gerissen und als Prophezeiung gedeutet, müssten eigentlich ernüchtern. Denn wenn diese Ankündigung zutrifft – und sie trifft zu – wie uns die Erfahrung lehrt, dann müssen sich die Christen fragen lassen: Für wen oder was ist der Mann aus Nazareth am Kreuz gestorben? Was hat sein Gehorsam gebracht? Was ist denn nach seinem Tod anders als vorher? Stefan Heym, DDR-Schriftsteller und ehemaliger PDS-Abgeordneter im Deutschen Bundestag, legt in seinem Roman Ahasver seine Finger in diese schwärende Wunde der Christenheit: Was ist eigentlich besser geworden in dieser Welt seit Christus, durch Christus und die Christen? Als Schriftsteller vermag er dies in einer ungemein bedrängenden Weise. Ahasver, der ewige Jude, die Hauptgestalt des Romans, durchstreift seit dem Tode Jesu – gemäß der legendären Vorlage – ruhelos die Welt und vermag keine Wende zum Besseren festzustellen. In der Rahmenhandlung, die im 16. Jahrhundert spielt, stellt er die für jeden Christen damals und heute peinliche Frage nach der Welt verändernden und Not wendenden Kraft des Christentums. Die Frage ist an einen Zeitgenossen Luthers gerichtet, den evangelischen Superintendenten Paul von Eitzen – es hätte auch ein römischer Papst sein können, eine Frage, die jeden Christen nach Worten ringen lässt und die ehrlichen unter ihnen zutiefst beschämt:
Wo ist der ewige Friede?
„…wo ist der ewige Friede, und wo das Reich, das da kommen sollte mit ihm und durch ihn? Noch immer ißt Adam sein Brot im Schweiß seines Angesichts, und Eva gebiert in Schmerzen, noch immer schlägt Kain den Abel, und ‚Ihr, Herr Doktor‘, spricht er zu Eitzen gewandt, ‚ich hätt nicht bemerkt, in all der Zeit, da ich Euch gekannt, daß Ihr Eure Feinde besonders geliebt, oder gesegnet hättet, die Euch fluchten, oder gebetet für die, welche Euch beleidigten wie Euer Herr Jesus gepredigt auf dem Berg, noch tun’s die andern, die sich nach Christus nennen.“
Ein Wutausbruch, wie bei Paul von Eitzen, dürfte jedenfalls nicht die Antwort auf diese Frage sein, die jeden Christen und seinen Glauben an einen allmächtigen Gott an empfindlichster Stelle trifft.
Arme werdet ihr immer unter euch haben
will daher Zweierlei sagen:
Gott ist kein Deus ex machina
- Erstens, Gott löst die Not dieser Welt nicht wie der deus ex machina in den Schauspielen der griechischen Antike: Er fegt nicht mit seiner Allmacht über die Bühne der Welt, unwiderstehlich jedes Leid und alle Not daraus zu verbannen. Es wird immer ein Stück menschliche Arbeit und christlicher Auftrag bleiben, Elend und Not nicht übermächtig werden zu lassen. Wir werden sie nur schwer auf ein erträgliches Maß niederhalten können. Aber das Reich Gottes oder das himmlische Jerusalem, an dessen Anbruch wir seit und in Christus glauben, ist nicht nur eine geistig-spirituelle und jenseitige Größe, sondern sollte auch ihren Niederschlag in der sozialen Ordnung menschlicher Gemeinschaft ihren Ausdruck finden.
Glaube und Vertrauen – eine Geduldsprobe
- Zweitens, Not und Elend in dieser Welt sind so sehr von dieser Welt, dass sie erst mit dieser Welt aufhören. Sie werden offensichtlich erst vergehen, wenn die „Gestalt dieser Welt vergeht“ (1 Kor 7,31). Stefan Heym hat daher nicht nur seine Finger in die Wunden der Christenheit gelegt. Der Glaube überhaupt an den zugleich allmächtigen und allgütigen Gott wird hier auf eine harte Probe gestellt. Es bleibt für uns schwer begreiflich, wie der liebende Gott aus dem Gleichnis vom barmherzigen Vater und gleichermaßen mächtige Gott erst am Ende der Zeiten „mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels“ (Mt 26,64par) kommen soll, aber bis dahin offensichtlich verlorene Söhne und Töchter in einer unbehausten Welt leben und sterben lässt, oft so grausam und dramatisch, dass keine der „vielen Wohnungen im Hause des Vaters“ (Joh 14,2) hinreicht, das Maß der Unbehaustheit im Diesseits im Jenseits aufzuwiegen. Die Wunden, die uns das Leben in der Zeit schlägt, erscheinen uns so groß, dass kein Pflaster in der Ewigkeit sie zu heilen vermag.
Zeichen der Hoffnung
- Drittens darf aber auch darauf hingewiesen werden, dass das Christentum doch nicht ganz folgen- und erfolglos gewesen ist, wie Stefan Heym suggerieren möchte. Schon in der Antike überliefert ein ganz unverdächtiger Zeuge, dass mit dem Christentum ein Einschnitt in die Armutsproblematik der Antike stattgefunden hat: Julian Apostata, der römische Kaiser, der das Rad der Geschichte noch einmal zurückdrehen und das Christentum aus der Welt schaffen wollte, muss gestehen: „Es ist eine Schande, wenn von den Juden nicht ein einziger um Unterstützung nachsuchen muss, während die gottlosen Galiläer [Christen] neben ihren eigenen [Armen] auch noch die unsrigen ernähren, die unsrigen aber der Hilfe von unserer Seite entbehren müssen.“[1]
Der sinnfällige Verbund von Macht und Liebe im Auferstandenen
Die sogenannte „Soziale Frage“ – das Wort bezieht sich ursprünglich auf die ungerechte Sozialordnung im 19. Jahrhundert – ist nur ein Mosaiksteinchen menschlicher Not in den Zeiten zwischen Ankunft und Wiederkunft Christi. Deshalb muss sich jeder fragen unter welcher Perspektive er als Christ lebt: Ganz eingepfercht im Diesseits, mit dem unerbittlichen Ende des Todes vor Augen, wie Menschen der Gesinnung Stefan Heyms, ohne Hoffnung darauf, dass dieser „letzte Feind“ – nach Paulus – (1 Kor 15,26) entmachtet werden könnte? Oder leben wir in der Zeit zwischen Ankunft und Wiederkunft Christi ganz in der Vision, dass auch der mächtigste Feind des Lebens, der Tod, besiegt worden, Christus der „Erstgeborene der Toten“ ist (Kol 1,18) und wir seine Nachgeborenen? Anders gewendet, können wir aus der Vision leben, aus der z. B. der geborene Jude und vor einigen Jahren verstorbene Kardinal von Paris, Jean Marie Lustiger lebte? Für ihn gibt es eine Ankunft des Messias in Ohnmächtigkeit in Jesus von Nazareth, an die wir Christen alle glauben. Er glaubt aber auch, wie die Juden, an eine Ankunft des Messias in Allmächtigkeit. Für uns Christen ist es die Wiederkunft Christi auf den „Wolken des Himmels“ (Mt 26,64par), die in unserem Glaubensbekenntnis fast zu einer quantité négligable verkommen ist. Insbesondere der evangelische Theologe Wolfhart Pannenberg aus München wies immer wieder auf diese Gemeinsamkeit des Glaubens aller Christen hin. Jean Marie Lustiger hat in bemerkenswerter Weise darauf aufmerksam gemacht, dass die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit nichts anderes ist als der alte Messiasglaube des Gottesvolkes des ersten Bundes.
„Man muss das Gute tun, damit es in der Welt sei.“
Diese Visionen, die Ankunft des Menschensohnes in Niedrigkeit, im Futtertrog Bethlehems und seine Wiederkunft in Herrlichkeit, auf den Wolken des Himmels, ergeben die Spannweite christlich gelebten Glaubens: Die Botschaft des Mannes aus Nazareth sollte einerseits bewegen mit aller Kraft den Einbruch des Reiches Gottes in diese Welt zu befördern, ganz schlicht in den Worten Marie von Ebner-Eschenbachs ausgedrückt: „Man muss das Gute tun, damit es in der Welt sei.“ Andererseits wird sich sein Reich weder mit, noch ohne Gewalt hier gänzlich herbeiführen lassen. Das ist als Absage an sozialistische und rein innerweltliche Visionen und Ideologien zu verstehen. Bis zur Wiederkunft Christi werden wir mit unvollkommenen Gesellschafts- und Sozialordnungen leben müssen. Die Soziale Frage wird sich uns in immer neuen Transformationen stellen, Arme hatten wir und Arme werden wir – so sehr uns das bedrücken muss, immer unter uns haben. Jeder Arme sollte ein Stachel in unserem Fleisch bleiben, unser Bestes zu geben, aber auch die Sehnsucht nach endgültiger Erlösung wach zu halten. Diese Sehnsucht kann andererseits weder von einer boomenden Wirtschaft betäubt, noch durch Vollbeschäftigung gänzlich erfüllt werden. Beides sind zwar schöne Träume, nicht nur jedes Wirtschafts- und Sozialpolitikers, sondern auch des einfachen Mannes auf der Straße. Sie werden aber immer das sprichwörtliche Linsenmus innerweltlichen Wohlergehens bleiben, das eine starke Versuchung darstellt, mit ihm das Erstgeburtsrecht wahrhaft christlichen Heils zu verkaufen. Wir sollten darüber hinaus lernen zu unterscheiden, was in der Kraft der ersten Vision verändert werden kann und mit welchen Unvollkommenheiten wir im Licht der zweiten Vision leben müssen, bis der Messias im Advent der Juden endlich ankommt, an Ostern seine Allmacht und Liebe sinnfällig gezeigt hat und in der Parusie der Christen schließlich wiederkehrt.
[1] Vgl. Dassmann, Ernst: Nächstenliebe unter den Bedingungen der Knappheit. Zum Problem der Prioritäten und Grenzen der Caritas in frühchristlicher Zeit. In: Jahres- und Tagungsbericht der Görresgesellschaft 1996. Hg. von der Görresgesellschaft. O. O., o. J., 90. Vgl. im genannten Werk weitere Beispiele frühchristlicher Sorge für die Armen über die Gemeinschaft der jungen Kirche hinaus.
Dr. phil. Helmut Müller
Philosoph und Theologe, akademischer Direktor am Institut für Katholische Theologie der Universität Koblenz. Autor u.a. des Buches „Hineingenommen in die Liebe“, FE-Medien Verlag