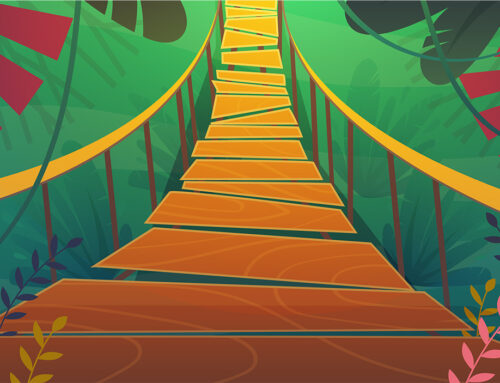Eine Rezension mit sehr persönlicher Note von Bernhard Meuser zu Bischof Georg Bätzings Buch „Rom ist kein Gegner“.
Warum ich der falsche Rezensent bin
„Rom ist kein Gegner“ heißt das Interviewbuch, mit dem Georg Bätzing in diesen Tagen an die Öffentlichkeit tritt. Und ich soll es rezensieren. Ich habe die 128 Seiten vorab gelesen. Einmal. Zweimal. Dann dachte ich: Gib den Job zurück! Du bist der falsche Mann dazu. Du tust ihm Unrecht. Obwohl ich seit Jahr und Tag für Gott und die Kirche arbeite – ja mich ohne einen Anflug von Pathos zu sagen getraue, dass ich sie liebe – ist mir dieses Buch so fremd geblieben wie ein Roman vom Mond.
Eine innere Stimme sagte mir schließlich: Gib den Job nicht zurück! Versuche dich erst gar nicht in routinierter Objektivität! Sei subjektiv! Sage „ich“ und ergründe deine Fremdheit mit dem Elaborat eines Mannes, der „wir“ sagt, die Kirche und alle meint, die in Deutschland katholisch sind. Okay. Ich sage „ich“ und bekenne, dass ich das „wir“ von Georg Bätzing nicht mehr teilen kann. Haben wir nicht in der gleichen Kirche gelebt? Die gleichen Bücher gelesen? Den gleichen Gottesdienst gefeiert? Die gleichen Päpste erlebt? Was trennt uns dann?
Das Tor der Geschichte geht auf
Oberflächlich betrachtet, kommt „Rom ist kein Gegner“ so ministrantenhaft katholisch daher, dass man schon zweimal hinlesen muss, um die Bruchlinien und die Momente von Travestie zu erkennen, in denen sich ein anderer Kirchenbegriff in die traditionellen Paramente hüllt. Erkennbar sind Bätzing und sein Interviewpartner mit höchstem Eifer darum bemüht, römische wie innerdeutsche Bedenken zu zerstreuen, der Bischof von Limburg hintergehe den Papst und sei ein verkappter Schismatiker. Also bekundet der Bischof, der den „Traumberuf Priester“ (14) schon als Kind erkannte, wie sehr ihm „die Kirche mit ihrer Tradition, mit ihrer Lehre … unglaublich wichtig“ ist; ja, da habe ihn etwas „bis in die Knochen“ geprägt (9). Die Quelle seiner Berufung sei „wirklich die Messe“ (10). Eine katholische Kirche ohne Priester sei „undenkbar.“ (30) Was er zu bewahren suche, sei „die besondere sakramentale Struktur der katholischen Kirche“ (10), ja er sei geradezu ein „Fronleichnamspriester“ (10). Gleich danach ist aber von Schattenseiten einer sakramental verfassten Kirche die Rede, die man heute aufarbeiten müsse: „Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt, eine Unfreiheit im Glauben, die entscheidend zum Abbruch der Beichte“ (11) geführt habe. Heute brauche es „Gewaltenteilung und Machtkontrolle für jedes Amt in der Kirche“ (33). Theologie könne helfen, „den Kern zu bewahren, aber das Priesterliche in neue Berufsbilder zu übersetzen.“ (34)
Je weiter man seine Ermüdung ignoriert und sich im Text vorankämpft, begegnet man immer neuen Figuren von „sowohl als auch“. Irgendwie ist da von hoher „Wertschätzung des Zölibats“ (35) die Rede, was aber dann doch die Grundstruktur der Kirche aushöhle, „wenn es bei uns viel zu wenige Priester gibt und der sakramentale Dienst nicht mehr geleistet werden kann.“ Wozu der Papst, bittschön, die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe nicht „dogmatisieren“ (35) möge. Da bekundet der Limburger Bischof „eine unglaubliche Hochschätzung für die Vorgänger im Amt“ (36), freilich nicht für seinen unmittelbaren Vorgänger, der doch etliche junge Männer für das Priesteramt begeistern konnte, was man von ihm selbst nicht gerade behaupten kann. Im Grunde habe man ja schon lange die Brüchigkeit des Systems erkannt. Nun sei es an der Zeit, die Dinge „theologisch und kirchenpolitisch voranzubringen.“ (37) Vor allem kirchenpolitisch! Römische Stoppschilder in Serie hat Bätzing mit der ihm eigenen Nonchalance ignoriert, ausgesessen oder konterkarierend beantwortet: Man müsse im Dialog bleiben! Selbst Kardinal Schönborn beeindruckte „die Geduld, mit der vom Papst und von den römischen Dikasterien versucht wird, mit den deutschen Bischöfen im Gespräch zu bleiben und die Einheit und die Gemeinschaft zu wahren.“
Das Ganze mündet schließlich in einem ebenso offenherzigen wie aufschlussreichen Bekenntnis: „Jetzt hat sich das Tor der Geschichte wegen des Skandals des Missbrauchs noch einmal geöffnet, sodass wir gemeinsam angehen können, was schon lange drängt.“ (38)
„Was ich angefangen habe, das ziehe ich auch durch“
Es ist an der Zeit, wieder einmal „Ich“ zu sagen. Rückblende: Herbst 2018. Die MHG-Studie zum Missbrauch wird vorgestellt. Ihr Auftrag bestand darin, „missbrauchs-begünstigende systemische Faktoren innerhalb der Katholischen Kirche zu beleuchten.“ (74) Ich lese sofort, atemlos, denn ich bin selbst ein Betroffener. Und bin entsetzt, was mir da interpretatorisch vor die Nase gesetzt wird. Ich kenne Missbrauch von Innen – und das hier ist nicht die Wahrheit. Und ich bin noch einmal vom Donner gerührt, in welches bischöfliche Narrativ die „Ergebnisse“ dieser Studie bald darauf in Lingen gepresst werden. Statt hinzuschauen auf die konkreten Erfahrungen von Opfern werden die Täter auf elegante Weise exkulpiert, indem man Missbrauch sozialisiert und zum logischen Effekt einer strukturell gewaltförmigen Katholischen Kirche stilisiert. Damit waren es alle und keiner. Die tief betroffenen Handlungsträger von heute sind fein raus, sofern sie nicht wieder den „Bischof“ markieren, sich devot gebärden, dem Zeitgeist huldigen und den sensus communis moderieren, – und die bösen Bischöfe von gestern kann man exhumieren und nachträglich verdammen.
Das „Tor der Geschichte“ geht auf – mit dem kleinen Schönheitsfehler, den der Kardinal von Wien als „Instrumentalisierung des Missbrauchs“ erkannte, um bestimmte „Forderungen der Kirchenreform zu behandeln und versuchsweise zu entscheiden.“ Und das ist exakt die Stelle, an der ich als katholischer Christ „ich“ und „nein“ sage – und nicht „wir“ und „ja“. Ich bin nicht im Boot, wo ich eingemeindet werden soll für die kirchenpolitische Durchsetzungen partikulärer Interessen einer selbsternannten, von der Universalkirche abgekoppelten Reformelite („… sodass wir gemeinsam angehen können, was schon lange drängt.“)
Weil ich die Zweite Synodalversammlung in Frankfurt am Bildschirm mitverfolgen konnte, weil mich die Hysterie dieser Elite im Kairos ansprang, – und weil ich mich des Eindrucks nicht erwehren konnte, hier werde „Kirchenpolitik“ gemacht, hier werde getäuscht, getrickst, geschoben, um bestimmte altbekannte liberale Optionen durchzusetzen, macht es mir eher Angst, wenn Bätzing in seinem Buch bekennt: „Was ich angefangen habe, das ziehe ich auch durch.“ (22) Beispielsweise den „Handlungstext Beraten und Entscheiden. Den müssen wir jetzt umsetzen.“ Immer wieder diese gemischte Attitüde: Nach außen hin der Versteher, der Hörende, der Moderator, der Vermittler, – und eine Handbreit dahinter der entschlossene Politikfuchs, der Diplomat, der Durchsetzer einer neuen demokratisch organisierten Kirche von Merkel´scher Alternativlosigkeit. Auf den Schönheitsfehler, an dem, was da durchgeboxt werden soll, macht wiederum Kardinal Schönborn aufmerksam: „Die persönliche Verantwortung der Glaubensweitergabe kann der Bischof nicht an Gremien delegieren. Daher ist auch die Figur der freiwilligen Selbstbindung der Bischöfe an Beschlüsse von Synodalen Räten mit dem Herzstück der bischöflichen Sendung nicht vereinbar.“
„Ich“ will diese kirchliche Räterepublik nicht, die glaubt sie lebe, wenn sie tagt. Mich stößt die anachronistische, gott- und weltvergessene Esoterik ab, mit der sie pausenlos um sich selbst kreist. Ich will diese Bischöfe vom Schlage Bätzing nicht, die ihre apostolische Sendung regelmäßig vor Eintritt in den Sitzungssaal abgeben. Sie erinnern mich an den Oberst der französischen Nationalgarde, der 1848 hilflos der Auflösung seiner Truppe zusah und das geniale Bonmot produzierte: „Da ich das Haupt der Truppe bin, muss ich ihr wohl oder übel folgen.“
Die Kirche der Parteien
Kein vernünftiger Christ bezweifelt, dass sich die Kirche radikal neu aufstellen muss. Da haben nun also – unter holpernder Beteiligung von Bischöfen – fünf Jahre lange Funktionär:innen mit Funktionär:innen über wenig Anderes, als über Gremien und innerkirchliche Machtverteilung gesprochen und nebenbei die Kirche neu erfunden. Draußen ging die Welt in Trümmer. Die Kirche ist noch ein bisschen älter, kälter, kleiner und irrelevanter geworden. Die Intellektuellen nehmen sie nicht mehr ernst, die Frommen nicht mehr wahr und die Jungen gehen ihre eigenen Wege. Der religiöse Bildungsstand ist auf einem nie dagewesenen Tiefstand. 95 % der getauften Katholiken beteiligen sich nicht am kirchlichen Leben. Von den verbleibenden 5% nehmen noch ganze 20.000, meist altverdrossene Katholiken am Parteitag zu Fronleichnam in Erfurt teil. Vor den Ehrengästen Baerbock, Paus und Habeck mimt das Zentralkomitee ein staatstragendes „wir“ und glaubt, es dürfe für alle sprechen, die da nicht mehr hinfahren.
Tatsächlich ist die Katholische Kirche in Deutschland zerfallen in mindestens drei Parteien. In die Altgläubigen, die man besser nicht „Konservative“ nennt, denn welcher vernünftige Mensch ist heute kein Bewahrer des Kostbaren. Ich meine jene Gläubigen, die es mit tiefem Schmerz erfüllt, dass im Moment eine große Synthese aus Kultur und Religion zerbricht, die aber nicht sehen, dass sich wandeln muss, was lebendig ist. Sie haben Bätzing abgeschrieben, sind von ihm mit keinem Buch der Welt mehr zu erreichen. Als Vorsitzender der Bischofskonferenz müsste er der große Integrator aller sein. Tatsächlich ist er der Parteivorsitzende jenes liberalen Reformflügels, der gerade einen neuen Feind erkennt: die Neuevangelisierung, mit all den jungen charismatischen und missionarischen Bewegungen. An Pfingsten zeigte sich, wie stark diese dritte Partei ist, die keine Partei sein möchte, sich deshalb am offiziellen Spiel gar nicht erst beteiligt und einfach fröhlich Kirche ist. Böse! Das „System“ wittert wohl Konkurrenz, wo es sich besser mit der Zukunft und der nächsten Generation anfreunden und alle Kraft in ihren missionarischen Turnaround investieren sollte. Hat nicht der Papst mit flehentlichen Worten die missionarische Dynamisierung der Kirche in Deutschland angemahnt?
Das Wort „Neuevangelisierung“ kommt in Bätzings Buch leider nicht ein einziges Mal vor, – dafür „Mission“ – immerhin Wesen und Auftrag der Kirche – allerdings nur in der Wortkombination „Kommission“. Das sagt alles. Sie müssen dieses Buch nicht lesen, sage „Ich“.
Bernhard Meuser
Jahrgang 1953, ist Theologe, Publizist und renommierter Autor zahlreicher Bestseller (u.a. „Christ sein für Einsteiger“, „Beten, eine Sehnsucht“, „Sternstunden“). Er war Initiator und Mitautor des 2011 erschienenen Jugendkatechismus „Youcat“. In seinem Buch „Freie Liebe – Über neue Sexualmoral“ (Fontis Verlag 2020), formuliert er Ecksteine für eine wirklich erneuerte Sexualmoral.
Der Beitrag erschien zuerst in der Tagespost
Illustration: Screenshot des Livestream von der Buchvorstellung im Haus am Dom in Frankfurt