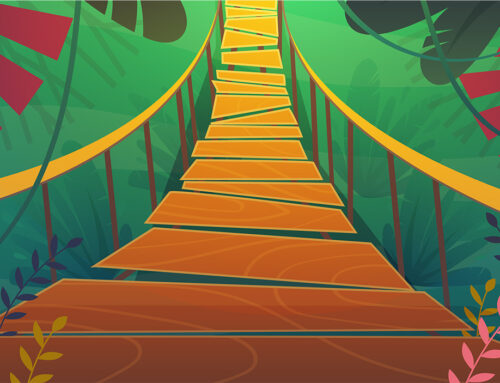Omnia nostra – Wie das Gute in den Kulturen grundgelegt ist
Vortrag von Prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, gehalten am 5. Online-Studientag der Initiative Neuer Anfang am 30. Oktober 2022. Auch als Video-Vortrag hier unter dem Link auf dem Youtube-Kanal sehbar.
Das Gesetz des Lebens, nomos zoes, die Weltordnung, die Thora ist immer schon eingepflanzt. So die These, bei Griechen oder Juden. Auch wenn die großen Religionen in der Vorstellung der Götter uneinheitlich sind, erst recht, wenn wir die Blick auf die Offenbarung des einen Gottes (in drei Personen) richten, so sind sie doch erstaunlich einig in der Abwehr des Bösen und im Bestimmen des Guten. Die Zehn Gebote des Mose, die fünf Gebote des Buddha, die Gesetzgebung des Hammurabi im Orient, des Minos bei den Griechen, die Gesetze anderer Völker ähneln sich in den Grundzügen: nicht stehlen, nicht lügen, nicht ehebrechen, nicht morden… Damit ist klar, was nicht gut ist. Aber was ist gut?
Auf jeden Fall: die göttlichen Mächte ehren, die Eltern ehren, bestimmte Mutter- und Vaterrechte wahren… Das heißt Gutes tun, aber was ist das Gute? „Das Gute ist ungeschaffen; es hätte niemals anders sein können; es hat keinen Schatten des Zufälligen (Kontingenten) in sich; es liegt, wie Platon sage, jenseits der Existenz. Es ist das Rita der Hindus, durch das die Götter selbst göttlich sind, das Tao der Chinesen, aus dem alles, was wirklich ist, hervorgeht.“ C. S. Lewis The Poison of Subjectivism, 107. „Auch die Chinesen sprechen von einem großen Ding (dem größten Ding), genannt Tao. Es ist die Wirklichkeit über allen Prädikaten, der Abgrund, der vor dem Schöpfer Selbst war.“ (Abolition of Man, 30)
4 Ausgestaltungen des Guten
Sprechen wir also über das Gute, und sei es zunächst nur, um das als Böse Erkannte abzuwehren. Sprechen wir zuerst über die großen Kräfte, um Wirklichkeit zu ordnen, zu bestehen und sie gut zu bestehen. Dann tritt das Gute aus seiner Allgemeinheit heraus und wird anschaulich.
Das Gute braucht vier große Kräfte, um sich durchzusetzen: vier (kraftvolle) kardinale Dienste an der Welt, vier „Türangeln“: 4 ist die Weltzahl: 4 Jahreszeiten, 4 Himmelsrichtungen, 4 Enden der Erde… von China bis Griechenland, auch 4 Ausgestaltungen des Guten. Diese Dienste sind Kräfte, Tugenden, aretai; sie bezeichnen im Griechischen die menschlichen Haltungen (hexeis), mit denen man die Wirklichkeit besteht. Sie stecken die Ethik ab, das Ethos, wörtlich den „Weidezaun“, wie ja überhaupt viele griechische Begriffe aus der Bauern- und Fischersprache stammen. Im Weidezaun bleibt die Herde in Schutz, außerhalb herrschen Verwirrung und Bedrohung. Das Ethos schafft also den Raum einer lebensdienlichen Wirklichkeit; es markiert die Grenze zum Unbestehbaren, schützt vor der Auflösung durch die Lüge, die ins Unwirkliche leitet. Zu solchen Zerstörungen führen auch Extreme, und es gibt sie vor allem im Bereich starker Gefühle, sogar, ja gerade dort, im Bereich der Liebe, der falsch verstandenen Liebe.
Die griechische Antike hat mit Aristoteles unterschieden zwischen Kräften, die im rechten Maß zwischen Extremen liegen: den ethischen Tugenden, und jenen, die überhaupt kein Maß brauchen, sondern in der Übersteigung, im „äußersten Einsatz an Kraft“ sich erst verwirklichen: die dianoetischen Tugenden. Die erste Kraft bedarf der Abschätzung der Relationen zwischen zu viel und zu wenig, des Augenmaßes, der Einschätzung der Lage; sie ist aus sich heraus gefährdet, weil solche Kraft auch in Macht, ins Bemächtigen, oder in falsche Rücksichtnahme aus Feigheit und Ohnmacht abgleiten kann. So steht z.B. die Tapferkeit gefährdet zwischen Tollkühnheit und Feigheit.[1] Die zweite Kraft/Haltung zum Guten nimmt ihr Ziel absolut ins Auge, auf das sie allen Einsatz wirft, ein optimum virtutis, ihr Maß ist die Maßlosigkeit – wie Bernhard von Clairvaux von der Liebe sagt. Deswegen ist Tugend kurz zu übersetzen mit Kraft: im einen Fall Kraft zur punktgenauen Landung im Endlichen, im anderen Fall Kraft zum Wegstreben ins Unendliche.
Glaube, Hoffnung und Liebe, die „drei göttlichen Kräfte“, sind ein solches absolutes Streben ins Gute: Sie leisten Einsatz über allen Einsatz hinaus ins Unabschließbare, ins „immer mehr“. Der Drehpunkt des Handelns im Menschlichen aber, die kardinalen oder Angel-Tugenden, sind vier an Zahl wie das Weltgeviert: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Auf ihnen ruht das soziale, das gegenseitig geschuldete Gute. In ihrem Weidezaun/Ethos läßt sich zusammenleben.
Wir nehmen eine Kraft des Guten heraus und buchstabieren sie durch – kommen damit auf das Gute selbst. Diese eine beispielhafte Kraft ist Tapferkeit, oder besser Starkmut. Wer gut sein will, muß stark sein – gegen etwas und für etwas. Auch das ist ein Verstehen quer durch die Kulturen. Wir werden Mythen kennenlernen, in denen männliche und weibliche Helden das Gute bewirken. Für sich und für andere.
2. Was ist Starkmut?
Zum Starkmut gehören mehrere Arten von Mut, wie gleich zu sehen ist. Das deutsche Wort kommt von (ie. Verbum mo-): sich mühen, starken Willens sein, heftig nach etwas streben, ahd. muot (Substantiv): Sinn, Seele, Geist, Gemüt, Kraft des Denkens, Empfindens, Wollens. Mut bezeichnet also die inneren Triebkräfte, Gemütszustände, Erregungen und Empfindungen des Gefühls, auch als Gegenpol zum mäßigenden Verstand. Aber die inneren Triebkräfte äußern sich nicht einheitlich. Im Folgenden werden verschiedene, sogar scheinbar gegenläufige Muster von Starkmut gekennzeichnet. Alle aber halten stand einem Bedrohlichen, Unterjochenden, Bösen.
Was ist bedrohlich? Das Leben selbst. Genauer genommen: das menschliche Leben. Dasein ist nicht in sich stimmig, es ist von einer tiefen Verstörung berührt. Was wir über uns wissen: Der Mensch ist ein „zerbrechlich Wesen“. Die Kulturanthropologie spricht von einer Uneinheitlichkeit des Menschen: seiner gattungshaften Animalität (die sich u.a. im Geschlecht äußert, in einer unserer gefährlichsten Anlagen) und seiner Personalität (die sich im Gefühl, im seelischen Leben, im Geist äußert). Wir sind „kentaurische Wesen“ aus Tierleib und Menschenkopf: „Tier mit dem göttlichen Funken in sich (…) ein Streit des Tierischen und des Göttlichen in uns“[2].
Aber auch: Alles um uns Befindliche ist im selben Sinn zerbrechlich, endlich, zeitgebunden. Wir aber sind die einzigen Lebewesen, die darum wissen. Das bedeutet: die davon bis ins Innerste berührt und verstört sind. Kierkegaard, der „Entdecker“ der Existenz, der ihre Tiefen freilegte, wußte von der Angst am Boden des Daseins. Niemand ist Herr seines Lebens: weder des Anfangs noch des Endes, weder der Herkunft noch der Zukunft; wir sind nicht einmal Herren im eigenen Leibe, wie Sigmund Freud „kränkend“ darlegte: vielmehr Beute unseres Unbewußten, einer Triebwelt, die wenig zu beaufsichtigen ist.. „In die freie Höhe willst du, nach Sternen dürstet deine Seele. Aber auch deine schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit. Deine wilden Hunde wollen in die Freiheit, sie bellen vor Lust in ihrem Keller, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet.“[3] Das sogenannte „Natürliche“ ist brüchig, von einem eigenartigen Makel durchsetzt. Das immer neue Ärgernis, jedem Menschen ärgerlich neu zum Anstoß, lautet: daß das Ganze unseres Daseins tief irritiert ist. Wie das Barock unübertrefflich grob-lapidar formulierte: humus fumus sumus.
„Mängelwesen Mensch“ hieß die Analyse der condition humaine nüchtern bei Arnold Gehlen. Anders: Die Anthropologie trifft auf das eingewurzelte menschliche Leid am krummen Wuchs, wie Nietzsche es nennen würde, der einer der Verkünder des „prachtvollen Tieres“ war. „Adler und Panther“ stehen bei ihm als Vorbild des naiv-vitalen Menschen, und die Schwächlichen, Verletzten, dem Leben nicht Gewachsenen seien dessen Beleidigung. Die markigen Sätze solcher Lebensphilosophie rühren einen archetypischen Instinkt an und haben ohne Zweifel auch nicht einfach Unrecht: daß es besser wäre, gesund als krank zu sein, oder um es mit dem gängigen Slogan auszudrücken: besser reich und schön als arm und häßlich. Aber die Normalität lautet umgekehrt: Gebrochensein ist konstitutiv für alles Menschliche, nicht willensabhängig, sondern unvermeidlich. „Leidwesen Mensch“…[4] Und so machen wir andere leiden.
Halbsein und Schuldigwerden gehört jedenfalls zu den menschlichen Grunderfahrungen. „Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht“, so Georg Büchner im Woyzek.[5]
Daher braucht man Starkmut, um das gebrochene Leben zu bestehen – und um andere nicht zusätzlich zu brechen.
3. Starkmut im Tun: Töten des Bösen
Zuerst ist Starkmut natürlicherweise ein Eintreten für und damit ein Kampf gegen. Der erste ursprüngliche Starkmut ist schon der Lebenswille: täglich, immer wieder, die Angst besiegen, zu kurz zu kommen. Vielmehr: auch anderen Raum zu geben.
Es gibt Urbilder des Starkmuts schon in den altorientalischen Mythen, den gelungenen Menschen: Es ist der Held, der die Proben besteht, gleich zehnfach wie der griechische Herkules: den Löwen besiegen, den Stall des Augias ausmisten, am Scheideweg die richtige Entscheidung nach rechts treffen…; oder jemand stellt die Weltordnung her; der nordische Siegfried mäht die Feinde nieder, bis er selbst getroffen wird; David besiegt Goliath; Judith schlägt Holofernes den Kopf ab… Immer ist es ein junger Mensch in der Vollkraft gegen das tödlich Lähmende, gegen die alte Unordnung der Welt; „Krieg der Sterne“…
Ein Sinnbild aller Gefahr ist der Drache. Auch der Ritter Georg reitet gegen den Drachen und befreit die Jungfrau – in ihr gipfelt symbolisch das wahre, tiefe, große Leben. Solche Befreiung ist ein großer und männlicher Dienst. Drachenkampf ist mehr als ein Öko-, Psycho- und Esoterik-Thriller. Er ist Kampf auf Leben und Tod. Wer sich dem Kampf nicht stellen will, hat bereits verloren. Er hat die Spielregeln des Bösen übernommen, und das kennt seinerseits keine Gnade, sondern bringt seine Gesetzmäßigkeit zur automatischen Geltung. Bis der, der den Kampf scheute, willenlos unterworfen und begraben unter dem Drachenleib die Gegenwehr verliert.
Ist es nur ein männlicher Dienst? Es gehört zur Personwerdung durch die biblische Offenbarung, daß auch Frauen den Starkmut übernehmen. Die kriegerische Göttin gibt es schon in der alten Welt des Vorderen Orients, in der Göttin Innana, in der gewappneten Athene, in der ägyptischen Isis, aber sie bleiben zweideutig: Kämpfen sie für das Gute und Rechte oder stehen sie auf der Seite der Zerstörung und des Todes? Das entscheidet sich erst nach Lage der Dinge und ist in sich nicht gefestigt. Innana kann im Blut waten, wenn sie zur Rache schreitet.
Im Alten Testament treten Frauen – nicht Göttinnen – in die Abwehr des Bösen. Auch sie können töten wie Judith den Holofernes; er verkörpert den Drachen, der Israel verschlingen will. Esther, umgekehrt, tritt für ihr Volk bis zum drohenden eigenen Tod ein. Die Mutter der sieben makkabäischen Brüder ermuntert ihre Kinder zum gewaltlosen, wenn auch wortreichen Widerstand angesichts der Folter: für den einen Gott zu sterben.
Im Christentum erstehen aus dem Vorbild Jesu die starken Frauen und die zahllosen Jungfrauen und Martyrerinnen der Frühzeit. Zwei davon bildet die Legende ebenfalls mit dem Drachen ab: Martha von Bethanien und die Martyrerin Margaretha, eine der drei Nothelferinnen. Beide haben den Drachen bezwungen. Das Eigenartige ist, daß Georg den Drachen tötet, während Margaretha ihn zähmt, nämlich in der bildlichen Darstellung an einer Leine führt.[6] Töten oder Zähmen? Beides ist möglich und richtig. Befassen wir uns mit dem Starkmut im Zähmen. Im Folgenden kommen einzelne Übungen oder Leitersprossen, wie das Böse niederzuhalten ist. Auch hier stimmen die Kulturen der Welt weithin überein.
4. Starkmut im Nicht-Tun: im Blick auf das Gute
4.1 Geduld, Langmut: Kräfte im Zähmen
Starkmut braucht es auch im Ertragen, im Standhalten gegenüber Schwierigkeiten, die sich nicht beseitigen lassen und das gute Wollen ermüden. So gehören nicht nur Taten, sondern ebenso Geduld und Askese zum Starkmut. Das wird vor allem in den indischen Traditionen geübt. Überhaupt wird jede Tugend erst im Durchhalten gesichert, das allen Schwierigkeiten trotzt. Nach Thomas von Aquin (STh 2,2 q123 a6) ist Standhalten sogar die wichtigste Leistung der Tapferkeit. Sie entfaltet sich besonders in Geduld (STh 2,2 q134 a4) und Beharrlichkeit (ebd. q137 a2); einen Höhepunkt erreicht sie im Martyrium (ebd. q124). Zum Starkmut gehört also auch die Tugend des Langmuts, „die tägliche Form der Liebe” (J. Ratzinger). Augustinus beschreibt Geduld als „eine so große Gabe Gottes, dass man sie die in uns liegende Spur Gottes nennen muß“. (De patientia, 1) Paulus zählt die Langmut zu den Früchten des Heiligen Geistes. (Gal 5,22) Dazu genauer unter dem nächsten Stichwort.
4.2 Tapferkeit des Herzens
Unvermutet zeigt sich Starkmut als erkämpfte Gelassenheit, als Verzicht auf das Zurückschlagen. In dieser Wendung gehört er zu den Kräften, die nicht ins Auge fallen. Sie spielen sich im Inneren ab, als Orkan, als Kampf, als Wehmut, die durchzustehen sind. Und dabei so viel Kraft brauchen, daß der Kämpfende nach außen ruhig wirkt, eher konzentriert, ein wenig abgeschlossen, um sich nicht ablenken zu lassen vom Notwendigen: von der Aufmerksamkeit auf den Gegner im Inneren. Hier gibt es viel Verwundenes, viel Überwundenes, vieles, was als Verlorenes zurückbleiben muß. Es gibt eine Tapferkeit, die den Tapferen so beansprucht, daß er, um Kraft zu sparen, nur nach vorne blicken kann.
So beschaffen ist die Tapferkeit des Herzens. Sie mißt sich nicht an ihren Taten, sondern an dem, was nicht geschieht: kein Ausbruch von Zorn, keine Wehleidigkeit, kein Nachrechnen. Sie läßt alles sein außer der Zuspitzung der Kraft auf das äußere und – langsam wachsend – das innere Stillhalten. „Tapfer ist der Löwensieger, tapfer ist der Weltbezwinger, tapfrer, wer sich selbst bezwang“, nennt Herder diesen Zustand. Denn er ist weniger ein Handeln als ein Zustand: ein Ringen um Gleichgewicht, ohne den Platz zu verlassen und ohne Beute zu machen. Wenn jemand dabei siegt, hat sich im Sichtbaren nichts verändert. Alles ist wie zuvor; nur dem Auge kenntlich, das am winzigen Schwanken des Helden merkt, welches Drama auf der unsichtbaren Bühne gespielt wird.
Es gibt Starkmut in der Gestalt von Nichttun, von Bewegungslosigkeit, von Abfangen. Der keltische Mythos kennt den Helden Fionn, der in seiner Jugend einen unbezwingbaren zauberischen Gott bezwingt. Dieser schläfert den Gegner mit einem unirdischen, berückenden Ton ein – worauf eine wilde blaue Flamme aus seinem Mund pfeift und den Schlafenden zu Asche brennt. Doch Fionn „breitete seinen gefransten Mantel aus und fing die Flamme auf – vielmehr, er fing sie ab, denn sie glitt von seinem Mantel und fuhr sechsundzwanzig Spannen tief in die Erde […] Aillen blies ein zweites Mal mit der ganzen schrecklichen Macht, die ihm gehorchte, und der große Strahl blauer Flamme fuhr brüllend und pfeifend aus ihm und wurde gefangen und verschwand.“[7]
Ein solches Abfangen der Bosheit, eigener und fremder, ist nicht nichts. Es entspricht dem Ausreißen und Wegstemmen einer Säule, wie sie im Barock auf den Schultern einer sinnbildlichen Fortitudo, der als Frau ausschreitenden Tapferkeit, zu sehen ist. Denn es sind nicht allein Helden der Vorzeit, sondern vor allem viele Frauen, die eine solche tapfere Weisheit üben: das Auge im Orkan zu sein, die Ruhe im Sturm, das Schweigen in der Anklage. Sie gehören zu denen, die neben den Helden der großen Abenteuer stehen, als jene, die sich selbst zügelnd in die Hand nehmen. Es gibt offenbar eine Sanftmut, die sich mit Selbstbeherrschung verbündet und nichts mit Schwäche zu tun hat. So die Braut, die wartet, während die falsche Nebenbuhlerin zur Hochzeit rüstet.
4.3 Stehenlassen von Beleidigung
Eine andere Erzählung aus keltischem Erbe beleuchtet hinreißend die Gewalt, ja die Erschöpfung, um die es in einer solchen Selbstbezwingung geht. Der Sagenkreis um König Artus enthält die Gestalt des größten aller Ritter, nämlich Sir Lancelots, der später durch seine Liebe zu Königin Ginevra in Schuld fällt. Bevor dies geschieht, berichtet die Sage von Lancelots Ausritt mit seinem noch unerprobten Neffen Lyonel, einem jungen, dummen Hund, der dem Onkel junge, dumme Fragen stellt. Eine davon ist frech und ehrenrührig. „Ein Anfall schwarzen Grimms schüttelte Sir Lancelot, verzerrte seine Lippen, so daß sie die Zähne entblößten. Die rechte Hand schnellte wie eine Schlange nach dem Schwertgriff, und die silberne Klinge glitt halb aus der Scheide. Lyonel spürte schon den Hauch des Todesstreiches seine Wange streifen. Dann sah er in ein und demselben Mann einen so wilden Kampf entbrennen, wie er ihn noch nie zwischen zwei Männern erlebt hatte. Er sah, wie Wunden geschlagen und empfangen wurden, wie es ein Herz beinahe zerriß. Und er sah auch den errungenen Sieg, das Abebben der Wut, sah Lancelots bitteren Triumph, die von Schweiß umflossenen, fiebernden, wie bei einem Habicht fast geschlossenen Augen, sah den rechten Arm an die Leine gelegt, indes die Klinge wieder in ihren Zwinger zurückglitt.“ Dem Kampf mit den eigenen Leidenschaften folgt nach außen ein Lächeln und Darüber-Hinweggehen, nach innen tödliche Erschöpfung. „Sir Lancelot legte sich unter dem Apfelbaum ins Gras […] Sir Lyonel setzte sich neben seinen Onkel. Er war sich bewußt, daß er eine Größe erschaut hatte, die den Verstand überstieg, und einen Mut, der Worten etwas Feiges gab, und einen Frieden, der mit höchster Qual erkauft werden mußte. Und Lyonel kam sich klein und niedrig vor wie eine Schmeißfliege, während Sir Lancelot wie aus Alabaster gemeißelt dalag und schlief.“[8]
Alabaster – darin sehen wir den „Glanz des Guten“.
In solchen großen Erzählungen sammelt und klärt das abendländische Gedächtnis die vielgestaltigen Haltungen des Starkmuts. Tapferkeit des Herzens bei gleichzeitiger Sanftmut, Abstand von den Leidenschaften, Rücknahme der Selbstliebe, ja Stehenlassen der Beleidigung – das ist Kraft, nicht Schwäche. Sie gilt für Frauen wie für Männer, sie gilt sogar für Kinder.
Sie vermag das alltägliche Hauen und Stechen in Tapferkeit auf sich zu nehmen, Grimm abzufangen, Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Vielleicht sogar, nach einem winzigen Schwanken, es mit Gutem zu vergelten. „(E)s ist zu fragen, ob es nicht auch einmal, für eine Zeitlang, unvermeidlich werden könnte, dass dieses Standhalten, wie im Fall des Blutzeugnisses, in der Gestalt schweigender Wehrlosigkeit geschieht.“[9]
4.4 Antreten gegen die eigene Entschlusslosigkeit
Starkmut setzt nicht nur Leidensfähigkeit voraus, vielmehr auch Kraft zum Entschluß. Sören Kierkegaard, das religionsphilosophische Genie des 19. Jahrhunderts, zeigt in seiner dreifachen anthropologischen Stadienlehre zuerst das sinnlich-ästhetische Stadium des jungen Menschen: Er lebt im unmittelbaren Verhältnis zum Dasein, noch unreflektiert und selbstisch. Alles aufnehmen, alles spielerisch auf sich beziehen, sich hemmungslos jeweils durchsetzen – aber das Spiel mit der Fülle von Möglichkeiten vermeidet instinktiv jede (end)gültige Entscheidung zur Wirklichkeit. Deutlich wird das im Spiel mit der Liebe. Kierkegaard analysiert großartig das erotisch-flüchtige Begehren Don Juans: von Aleida bis Zuleima. Aber „alle“ Frauen bedeuten zugleich keine einzige wirkliche; so die Analyse von Mozarts „Don Giovanni“ in „Entweder-Oder“. Am Grunde dieses ästhetischen Genusses liegt Angst: die Freiheit der Möglichkeiten vor der Bestimmtheit und Endlichkeit der Wirklichkeit einzubüßen. Aber aus dem bloßen Spiel mit den Möglichkeiten folgt unabweislich Resignation. Alle Liebeleien sind eine leere Wiederholung des Unwirklichen. Endlich wählt der Ästhet ent-täuscht die Wirklichkeit, die eine Frau. Der Tapfere aber wählt sie positiv, mit aller Kraft, auch mit der Kraft, eine Enttäuschung in Kauf zu nehmen. Herkules ent-scheidet sich am Zweiweg. Das deutsche Wort ent-scheiden kann auch so gelesen werden: die Scheidung aufheben. Tapferkeit führt zur Lebenswirklichkeit, dem Bestehen des Endlichen. Chesterton gegen die Irrfahrten auf dem „Meer des Lebens“: „Ab und zu steigt im Hafen Rauch auf – wieder hat ein Feigling sein Schiff verbrannt und bleibt.“
5. Starkmut mitten in der Zumutung des Lebens
Alle solchen Erzählungen verdichten Grunderfahrungen, wie die Ordnungen des Daseins zu wahren sind, wie das Abenteuer der Welt und ihr Widerstand zu bestehen ist. Abgekürzt: Das Leben selbst ist die größte Zumutung. Es ist das größte Abenteuer. Leben braucht Starkmut, um gut zu werden.
Unter den Grundfiguren vieler Lebensreisen schält sich eine bestimmende heraus: das Bild vom erzwungenen Abstieg ins Ungewollte, Dunkle, (fast) Unbestehbare. In der Mitte sitzt, wie im griechischen Mythos, der Minotaurus, der Stiermensch, der alles frißt. In der Mitte vollzieht sich aber auch, wenn der Kampf aufgenommen wird oder eben einfach standgehalten wird, ein geheimnisvoller Umschwung. So muß die Schöne einem Tier als Braut folgen, die Königstochter mit dem Frosch ein Bett teilen, ein indischer König muß mit dem Schleppen von Leichen – der tiefsten Stufe der Unreinheit – seine unreife Regierung büßen, zu schweigen von den Helden, die durch Wasser und Feuer, über den Glasberg und durch den Drachenwald halbtot das nackte Leben retten. Und doch: Sie gehen zerlumpt ins Ziel als Sieger, während die Vorsichtigen und Listigen, die das Abenteuer des Lebens billiger haben wollen, leer ausgehen, weder die Braut noch das Königreich erben, oder wirken nicht – wie die Heldin – die Verwandlung des Bären in den Mann und König.
Das Geheimnis des Daseins ist verflochten in die Welt der unsichtbaren hellen oder dunklen Mächte. Es ist verflochten in Zumutungen, die den tiefsten Kern der Person anzielen, ihn verletzen und aufbrechen, möglicherweise aber ebenso heilen, sichern und beglücken – wenn, ja wenn bestimmte Wahrheiten beachtet werden.
Die grundlegendste Wahrheit heißt: das Dasein als Gabe leben, das Zugemutete als Gabe lieben. Die Gabe verbirgt noch den Geber, aber sie verheißt, ihn im „Kampf“ mit dem Leben aufzudecken: „sich an dem Starken stärker aufzulehnen“, nennt das Rilke. Leben kommt in Gestalt des Widerstandes gegen den eigenen Willen, im Ungewünschten, in der Härte – aber auch in der Umwandlung, im Gelingen und Gewinn.
Nietzsche (Jenseits von Gut und Böse): „Die Zucht des Leidens, des großen Leidens – wißt ihr nicht, daß nur diese Zucht alle Erhöhung des Menschen bisher geschaffen hat? Jene Spannung der Seele im Unglück, welche ihr die Stärke anzüchtet, ihr Schauer im Anblick des großen Zugrundegehens, ihre Empfindsamkeit und Tapferkeit im Tragen, Ausharren, ausdeuten, Ausnützen des Unglücks, und was ihr je von Tiefe, Geheimnis, Maske, Geist, List, Größe geschenkt worden ist – ist es nicht ihr unter Leiden, unter der Zucht des großen Leidens geschenkt worden?“
Leben ist die Zumutung, die Mut braucht. Aber „Zumutung“ ist ein zu dunkler Name für die unablässige Herausforderung, mit den Gaben des Lebens zu arbeiten. Vielmehr öffnet sich in der Zumutung ein zutiefst personaler Wille: Jemand wollte, daß ich sei und daß ich so sei.
Auch davon gibt es eine große Erzählung, die zeigt, daß das Üben erzwungen wird und daß jemand mit uns übt – Er, der uns ins Leben gesetzt hat. Geheimnisvoll sind die Kämpfe, die ab und zu fast das Leben kosten, Kämpfe, die unbestehbar sind und doch bestanden werden müssen.
6. Der Jakobskampf: Das Gute fordert zum Ringen heraus.
Eine solche Erzählung ist Jakobs Kampf mit Gott. Dieser Kampf in Genesis 32 öffnet einen geheimnisvollen Zusammenhang, der im unmittelbaren Begreifen nicht ganz aufgeht. Trotzdem bleibt der Text haften; er ist auch im Namen „Israel“ = Gottesstreiter haften geblieben bis auf den heutigen Tag. Der Jakobskampf erzählt nicht, wie es vor langer Zeit, weit zurückliegend, gewesen ist, sondern wie die bleibende Prägung auf dem Geschlecht der Gottesstreiter aussieht, das Siegel, unter dem alle Künftigen antreten. Solche Geschichte ist währendes Geschehen, und man tut gut daran, die Kraft des Geschehens als die große Linie zu begreifen, unter der Menschen in die Zukunft geschickt werden.
Entziffern wir zuerst die Erzählung: Jakob, der Flüchtling vor dem betrogenen Bruder Esau, kehrt nach Jahren in der Fremde reich in die Heimat zurück, der Segen seines Vaters Isaak hat sich ausgewirkt: Frauen, Kinder, Herden zeigen sichtbar die Huld Gottes; Reichtum hat sich im Überfluß eingestellt. Esau, der den Betrug nicht vergessen hat, zieht ihm jedoch entgegen, und Jakob – als Schuldiger – bleibt am sicheren Ufer zurück, er fühlt den Kampf voraus und fürchtet ihn. Es wird sich erweisen. ob der sichtbare Segen anhält oder ob Jakob erschlagen wird. Anstelle des Bruders aber, dem er ausweicht ringt plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, ein Unbekannter mit ihm – ein Engel, ein Bote? Oder Gott selbst? Zu dem Unbekannten gehört schon, daß diese Frage sich nicht schließt, auch am Ende nicht.
Der Kampf ist sonderbar, und wir folgen der Deutung Guardinis: Er ist „ein dunkles Ineinander von Übermacht und Schwächersein zugleich“[10]. Jakob siegt nach der endlosen Nacht, aber er hinkt, denn der andere hat seine Übermacht leichthin demonstriert – er brauchte Jakob nur zu berühren. Aber auch umgekehrt: Jakob hinkt, aber er siegt, denn der mächtige Unbekannte zeigt sich am Ende überwunden. Die Sonne geht auf, und Jakob trägt einen neuen Namen; damit trägt er eine neue Bestimmung und wird in ihr ein zweitesmal und diesmal rechtmäßig den Bruder bezwingen, nämlich durch Versöhnung.
Jakob ist nach Guardini einer der Großen in den Stationen des Heils, ein Mann der Kraft und Schläue. Er gerät in das Geheimnis Gottes, in die schwer zu bestehende Nähe zu Gott und wird darin gezeichnet. Er ist Begründer eines königlichen und hinkenden Geschlechts, das bis zum heutigen Tage fortdauert.
Kann man aber mit Gott wirklich kämpfen? Gibt es wirklich eine Entscheidung für ihn oder gegen ihn? Guardini sieht in der biblischen Überlieferung ein Doppeltes: Sie kennt Gott als den, dem nichts widersteht. Sie kennt ihn aber auch als den, der seine Übergröße zurücknehmen kann. Der Souverän kommt bittend, etwa in Nazareth; er kommt im Maß des Menschlichen, läßt sich fragen und gibt Auskunft. In der Jakobsgeschichte ist beides verbunden: der Unwiderstehliche und der Bezwingbare. Was bedeutet es, daß er im Kampf kommt oder seinen Boten zum Kämpfen schickt, dabei siegt und doch nicht siegt? Offenbar will er, so Guardini, daß der Mensch mit ihm kämpft, ja geheimnisvollerweise ihn bezwingt. Hier öffnet Guardini eine wunderbare Aussage über Gott und den Menschen: Gott will den Menschen ringen sehen – gerade weil er ihn als sein Bild geschaffen hat. Auch das gehört zum Ebenbild: nicht als Marionette und Befehlsempfänger geschaffen zu sein, mit dem Gott leichtes Spiel hätte, sondern als Freier, Starker zu leben, zu schaffen, zu gestalten, was zum eigenen Leben dient. Hier liegt die wunderbare Herausforderung zur Entscheidung: Die Liebe will, daß man mit ihr kämpft, daß man um Klärung für sein eigenes Leben kämpft, daß man sich kämpfend mit allen Fragen auf Gott einläßt. Es ist Liebe, die den Menschen nicht als bloßes Kind will. Natürlich gibt es das kindliche Dasein, das Gott nahesteht und dem er sich in rein vollendender Weise kundgibt. So müssen wir uns wohl die Kinder denken, die früh sterben: Guardini meint, daß Gott hier etwas an der Lebensleistung ergänzt oder daß ein solches Leben als reine Gabe gelebt und abgepflückt wird.. Aber das normale Dasein kennt nicht diese Form der frühen Begabung und Vollendung. Seine Normalität besteht im Treffen auf Widerstände, Ungelegenes, Verqueres auch im eigenen Herzen. Die mitgegebene Natur, der Umgang mit Freunden und Gegnern will bestanden werden, und das macht einerseits müde, andererseits ruft es sonst unentbundene Kraft heraus. Die Geschichte Jakobs klärt auf, daß in den Widerständen – zunächst ist ja nur der Bruder und Feind Esau erwartet – ein anderer uns antritt oder anspringt: ein Geheimnisvoller, der sein Visier nicht lüftet. Und er zeigt Macht: Wollte er, so würden wir unterliegen; er zeigt aber auch Bezwingbarkeit: Wollen wir, so können wir eine ganze Nacht lang kämpfen und ihn um Segen bitten. Dieses Ineinander von Herausforderung und Segen, von Widerstand und Sieg, von Nacht und schließlichem Sonnenaufgang ist eine Botschaft vom Wesen Gottes und Wesen des Erwählten. Was als Widerstand und scheinbare Zerstörung kommt, kommt – wenn der gute Kampf gekämpft ist – als Segen. Gottes Macht kommt nicht zerbrechend. Sie fordert ein Äußerstes an Kraft, ein optimum virtutis, aber sie überwältigt nicht. In der Gestalt des Widerstandes will sie als Liebe erfaßt werden.
Dies als Ermutigung, in der Nacht des Kampfes wie Jakob auszuhalten, bis die Sonne aufgeht. Es ist ja alles erkämpft, im Ringen gegen ihn, mit ihm.
7. Was ist das Gute?
„Omnia nostra“ sagte Augustinus in De doctrina christiana: gegen die Ausschaltung der antiken Philosophie durch Tertullian. Die Gestalt Christi war ja noch keineswegs in die damalige Kultur „übersetzt“. Es zeigte sich bedrohlich, daß einige frühere Lehrer, so Tertullian, Christus von der heidnischen Kultur fernhalten wollten: um die Reinheit der Lehre zu wahren und dabei die einfache Sprache der Fischer zu behalten. Augustinus gewann diesen „Kulturkampf“ glänzend. „Quisquis bonus verusque Christianus est, Domini sui esse intelligat, ubicunque invenerit, veritatem.“ (De doctrina christiana, cap. 18): „Wer immer ein guter und wahrer Christ ist, soll die Wahrheit einsehen, wo immer er sie findet.“ Spermata to logou: Es gibt die Samen der Wahrheit in allen Religionen, sagt das Vaticanum II. Alle sind Kinder des Schöpfers; alle leben aus dem ersten, unvergänglichen Anfang. Und alle sind abgestürzt, davon erzählen die Weisheitstraditionen, und alle können wieder aufstehen oder besser vom Urheber des Lebens wieder ins Leben zurückgeholt werden. Aber es gehört zur Größe der Gnade, daß sie unsere Mitwirkung wünscht.
Clemens von Alexandrien (um 150 Athen – 215 Kappadokien): „Die Griechen wurden durch die griechische Kultur auf Jesus Christus vorbereitet, so wie die Juden durch das Gesetz auf Jesus Christus vorbereitet wurden.“ „Alle Lampen Griechenlands brennen für die Sonne, die Christus heißt.“
Was ist das Gute? Es ist das, was alle Kräfte aufruft. Verschiedene Arten des Starkmuts (Geduld, Ausdauer, Großherzigkeit, Mut, Festigkeit, Offenheit und sogar die Bereitschaft, das Leben hinzugeben) können nur durchgehalten werden, wenn sie im Ursprung verankert sind, im Guten.
Aber in der Erfahrung des Jakobskampfes wird deutlich, daß das Gute nicht eine Sache, ein Ungreifbares, sondern eine Person ist, ein Du. Der Gute fordert uns heraus und hilft gleichzeitig: quia tu es fortitudo mea, denn du bist meine Stärke (Ps 31,5).
Gerade in der Verwundung fordert Gott den Menschen heraus, zu einem Wachsen zur Größe, zum Ringen mit seinem Ursprung. Daß der Mensch nicht zu einem Automatismus verurteilt ist, sondern sich entscheiden kann, zur eigenen Kraft greifen kann, ist eine der gewaltigsten unter den großen Gaben des Ebenbildes. „Wir sollen uns bemühen, den Dank auch auf das auszudehnen, was schwer ist. Was in der Vorsehungsbotschaft die größte Tapferkeit verlangt, aber auch die größte Verheißung bedeutet, ist, daß alles Geschehende, auch das Schwere, auch das Bittere, auch das Unverständliche, Bote und Gestalt der Gnade ist. Vom Glauben getragen, kann der Dank auch in das Schwere vordringen, und in dem Maße, als das gelingt, wird es verwandelt.“[11]
Was ist das Gute? Du, Gott, bist der Gute. Wenn man den Urwald der Welt durchdrungen hat, bestaubt, zerknittert, lahm und wund, kommt man bei Dir an und begreift, daß das Abenteuer zu Dir führte.
[1] Thomas von Aquin, Summa theologiae, listet die Extreme auf: Der Mensch läßt es an Tapferkeit fehlen, wenn er sich aus Furcht zu einem unrichtigen Verhalten bewegen läßt (2,2 q.125 aa.1.2), sich von Kleinmut beherrschen läßt (q.133 aa.1.2), sich in Kleinlichkeit (Minimalismus) auf ein Mindestmaß an Leistungen beschränken will (q.135 a.1), sich in Weichlichkeit jede sittliche Mühe ersparen will (q.138 a.1).
Er kann aber auch Zerrbilder an die Stelle der Tapferkeit setzten: falsche Furchtlosigkeit, wo Furcht angebracht wäre (q.126 aa.1.2); durch nichts gezügelte Verwegenheit (q.127 aa.1.2); Vermessenheit, die sich unvernünftig viel zutraut (q.130 aa.1.2); Ehrgeiz, der seine Kraft nicht für hohe Ziele, sondern für die eigene Erhöhung einsetzt (q.131 aa.1.2); Ruhmsucht, der es ebenfalls nicht um die Verwirklichung des Guten, sondern um eigenes Gelten geht (q. 132 aa.1.2).
[2] Eugen Fink, Spiel als Weltsymbol, Stuttgart 1960, 44.
[3] Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, WW XIII, 50.
[4] Herbert Schriefers, Leidwesen Mensch, in: Volker Becker/Heinrich Schipperges (Hg.), Krankheitsbegriff, Krankheitsforschung, Krankheitswesen, Berlin 1995, 77 – 91.
[5] Georg Büchner, Woyzek, Abschnitt 2, 7: „Die Straße“.
[6] H.-B. Gerl-Falkovitz, Zähmen oder töten? Die Frau mit dem Drachen, in: dies./H.-B. Wuermeling, Augenblicke. Annäherungen an das Christentum, München 1996, 34-40.
[7] James Stephens, Fionn der Held. Irische Sagen und Märchen. Übertragung und Einführung von Ida F. Görres, Heiligenkreuz 2017, xx53f. – Sollte Fionn eine historische Gestalt sein, so im 3. Jh. n. Chr. Vgl. Geoffrey Ashe, Kelten, Druiden und König Arthur. Mythologie der Britischen Inseln, Olten/Freiburg 1992.
[8] John Steinbeck, König Artus und die Heldentaten der Ritter seiner Tafelrunde, übers. v. Christian Spiel, Nachw. v. Lothar Hönnighausen, München 1992, 260f.
[9] Josef Pieper, Über den Glauben, München 19xx, 94; Pieper bezieht dieses Standhalten hier auf den Glauben gegen die eigenen Vernunftargumente.
[10] Romano Guardini, Jakobs Kampf mit Gott, in: Werkhefte junger Katholiken 1, 8 (1932), 2.
[11] Romano Guardini, Vorschule des Betens, Zürich/Köln 1975.
Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Religionsphilosophin und Ratzinger-Preisträgerin, ehem. TU Dresden, jetzt Professorin und Vorsitzende des Europ. Instituts für Philosophie und Religion, Heiligenkreuz, Synodalin Forum III (Frauen). Dieser Vortrag wurde am 30. Oktober 2022 im Rahmen des 5. Online-Studientags der Initiative „Neuer Anfang“ unter dem Titel „Der Glanz des Guten – Warum die christliche Moral ihre Zukunft noch vor such hat“ gehalten. Link zum Video-Votrag