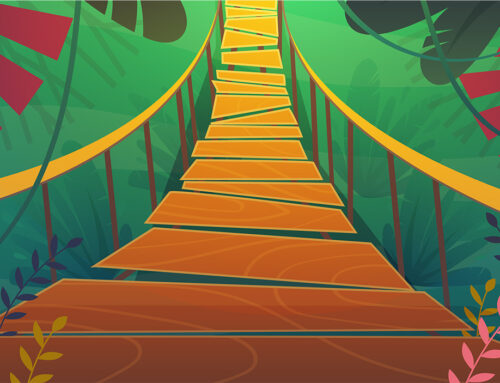Man muss dem „Synodalen Weg“ dankbar sein, dass er von der Katholischen Kirche in Deutschland ein Stück Verlogenheit genommen hat. Nach der „Frankfurter Erklärung“, nach „#out in church“, und nachdem sich eine Reihe von Bistümern durch Selbstverpflichtungen gebunden haben, die moralischen Ansichten und persönlichen Lebensumstände ihrer Mitarbeiter nicht mehr zu beachten, kommt es zu den erstaunlichsten Eröffnungen von Kirchenangestellten. So darf Eric Tilch, Jugendbildungsreferent bei der Jugendkirche Kana in Wiesbaden, auf der Homepage des Bistums Limburg bekunden: „Ich kann mich erst dann von der Kirche als schwuler Mann angenommen fühlen, wenn ich auch mit wechselnden Partnern akzeptiert werde.“ Der Kirche, die gerade die Grenzen ihrer moraltheologischen Flexibilität austestet, wird der nächste qualitative Sprung abverlangt: Die segnende Würdigung von Promiskuität.
Ein frommer Romantizismus
Und natürlich hat Eric Tilch in gewisser Weise recht. Wenn Bischöfe und Synodalen A sagen, müssen sie auch B sagen. Wer Ja sagt zu schwulem Sex, sagt auch Ja zu promiskuitiv schwulem Sex. Die Annahme, katholische männliche Homosexuelle würden sich ab Segnung von der Standardannahme des Milieus – nämlich der Unterscheidung von sozialer Treue und sexueller Treue – verabschieden, ist ein frommer Romantizismus.
Und wer meint, „Ehe für alle“ würde bei allen verpartnerten Katholiken eo ipso dazu führen, dass diese sich jeglichen Kinderwunsches enthalten, irrt folgenschwer. Auch sie werden zu Kindern kommen, durch Adoption, Insemination und Leihmutterschaft. Und wer sich wertschätzend zu vor-, außer und nebenehelichem Sex äußert, verkennt den systemischen Zusammenhang zwischen freiem Sex und Kindstötung; und er muss sich über die jungen Damen vom BDKJ nicht wundern, die äußerstes Verständnis für Abtreibungsärzte* zeigen und sich – statt sich auf dem Marsch für das Leben zu engagieren – für die Aufhebung des Werbeverbots § 219a kämpfen.
Und wer Ja sagt zu homosexuellem Sex, weil es sozusagen (der Natur des individuellen Begehrens nach) unabweisbar ist und so sein muss, der muss auch Ja sagen zu bisexuellem, polyamorem Begehren (es kommt übrigens doppelt so häufig vor wie manifestes gleichgeschlechtliches Begehren, zum Beispiel auch mitten in einer Ehe). Der Rattenschwanz der Varianten von Begehren ist so lange, dass nicht einmal Judith Butler sein Ende gesehen hat. Pädophiles Begehren ist übrigens auch ein Begehren. Die klassische Moraltheologie behalf sich mit der Unterscheidung zwischen geordnetem und ungeordnetem Begehren.
Es war einmal das Ruhmesblatt der Kirche, dass sie mit Zähnen und Klauen die Integrität des Ehesakramentes und der Familie verteidigte, weil sie wusste, dass nichts Männern, Frauen, Kindern und alten Menschen besser tut, als genau diese anfordernde Hochform der Liebe. Gerade verrät die deutsche Kirche diese fundamentale Option durch ein nicht einmal halb durchdachtes Verständnis für alles (Bätzing: „Wir nehmen doch niemand etwas“); sie hat, wo ihr die Felle und die Kirchensteuer wegschwimmen, grenzenloses Verständnis für die Ränder, die sich zur Mitte fressen. „Ich sorge mich“, darf sich Eric Tilch deshalb auf der Limburger Bistumsseite verbreiten, „dass die Kirche an einem Familienbild aus den 1950er Jahren hängt, also Vater, Mutter, Kind. Dabei gibt es so viel mehr als das, zum Beispiel Patchworkfamilien, wechselnde Beziehungen, polyamore Liebe …“
Bischöfe in der Moralfalle
Seit dem fatalen Schockenhoff-Referat in Lingen 2019 haben sich die deutschen Bischöfe in eine moraltheologische Falle manövriert, aus der sie so schnell nicht wieder herausfinden. Indem sie Homosexualität in die Mitte ihrer Reformbemühungen stellten – als gäbe es sonst nichts – haben sie nicht etwa das moraltheologische Repertoire beziehungsethisch erweitert, damit auch die im Licht sind, die zuvor im Schatten waren. Das wäre ein Anliegen gewesen. Denn Menschen, die sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen, dürfen in der Kirche nicht Menschen zweiter Klasse sein. Es musste aber gleich eine „neue Sexualmoral“ sein, die alles auf den Kopf stellt. Mit Drücken und Schieben soll an die Stelle einer alten, scheinbar menschenfeindlichen Moral eine neue treten, in der Menschen endlich so leben können, wie es ihnen (und nicht der Kirche) gefällt. Dass sich Papst Franziskus der pastoralen Sorge für Menschen, die aus dem klassischen Schema herausfallen, in Amoris Laetitia intensiv angenommen hat, erschien den Neueren vom Synodalen Weg als halbherzig und inkonsequent. In der Tat sieht alles nach einer kleinen sexuellen Revolution aus,
Eine kleine sexuelle Revolution
Die Synodalen – und mit ihnen die Bischöfe – haben nämlich implizit einem fundamentalen Neuansatz und Funktionswandel von Moral zugestimmt, von dem nicht sicher ist, dass alle seine Tragweite erkannten. Sie haben Sexualmoral nicht neu konzipiert; sie haben sie abgeschafft. Sie haben sich mit einer „Moral“ angefreundet, die in keiner Weise mehr kulpiert – also Menschen mit der Möglichkeit der Abweichung von Gottes Gebot konfrontiert. Die Hauptfunktion der neuen Moral ist, dass sie exkulpiert. Sie funktioniert als Tranquilizer – dazu da, gutes Gewissen zu machen, nicht länger, es zu schärfen. Die sexuelle Abweichung wird ohne Ansehen der näheren Umstände salviert. Mit einem Nebeneffekt: Die Kirche restituiert sich wieder als moralische Instanz. Sie tut es, indem sie Verkündigung einstellt, außer Toleranz nichts mehr predigt und Ermächtigungen für Regelbrüche wie Kamellen beim Rosenmontagsumzug verteilt.
Statt „Du musst dein Leben ändern, um der Regel gerecht zu werden“, sagt sie: „Wir ändern die Regel, damit Du dein Leben nicht ändern musst“. Damit ihre Ermächtigungen nicht Ermächtigung zum Bösen sind, schafft sie den Unterschied zwischen Gut und Böse ab. Den Anderen mit etwas Anderem als mit „er ist eben anders“ zu beurteilen, ist in Essen, Osnabrück und München Diskriminierung. Eine der Person übergeordnete geschöpfliche Natur – etwas, das „natürlich“ ist für alle – gibt es so wenig, wie es ein per se Böses oder per se Gutes gibt.
Im Konzept autonomer Selbstermächtigung ist erlaubt, was gefällt – sofern es dem anderen auch gefällt, mit dem es „beziehungsethisch“ gut verhandelt ist. Die neue Moral setzt die Freiheit des Menschen an den Anfang aller Dinge und gründet die Ethik auf das jeweils individuelle Begehren der Person. Der Markenkern dieser neuen Moral ist ihre Nichtmoral; ihre Ethik besteht in der ethischen Entkernung. Sie gefällt sich im Gestus anforderungsloser Menschenfreundlichkeit.
Jesus nicht mehrheitsfähig
Mit der Heiligen Schrift ist das schwer vereinbar. Sie ist ethisch überaus anfordernd. Sie diskriminiert die Sünde. Sie weist darauf hin, dass der Mensch sein Leben verspielen kann. Sie stellt uns, verlangt unsere Bekehrung. Die Bergpredigt Jesu ist nicht mehrheitsfähig, schon gar nicht Mt 19 (das Scheidungsverbot); und für Röm 1,25-27 kommt man heute schon in Finnland vors Gericht. Die neue Moral setzt sich dieser Gefährdung nicht aus. Im Konflikt mit den eigenen Dokumenten, der Heiligen Schrift und kirchlicher Lehre, entkräftet oder tilgt sie das Eindeutige durch Interpretation, nennt die klare Folgerung aus Gottes Gebot „unterkomplex“ oder „überholt“. Diese neue Moral leitet sich von nichts Transsubjektivem mehr her; sie ist konsequent anthropozentrisch. Bischof Overbeck: „Wie Menschen zu leben haben, lässt sich nicht mehr allgemein autoritativ verordnen, ohne das Gottesgeschenk der Autonomie mit Füßen zu treten.“ Man muss sich nichts mehr sagen lassen.
So wenig die neue Moral das Wort Gottes benötigt, so wenig braucht sie Gott selbst für das Gute – nicht, indem ER es setzt, nicht indem ER zu seiner Erlangung verhilft, nicht indem ER als Skandalon auf dem Weg anstößige Gegenwart in meinem Leben wird. Gott wird zum wohlwollenden Zuschauer unserer Handlungen; eigentlich ist er ethisch überflüssig; Menschen wissen selber, was gut für sie ist. Gott rückt uns nicht mehr auf die Pelle. Gott tut nicht mehr weh. ER wabert im Jenseits von Gut und Böse: ein vorüberfließender Fluss, aus dem das autonome Subjekt nach Bedarf Ermutigung und Lebenshilfe schöpft.
Der Versuch, eine massenkompatible, a-theistische „neue Sexualmoral“ zu etablieren, die allen gefällt und niemand verletzt, endet im Deismus und im menschlichen Selbstgespräch. Als Moral ist sie noch schwächer als die „gute Moral bei der Truppe“; sie ist ein sich gegen Kritik immunisierender selbstberuhigender Solipsismus. Eine theologische Moral rechnet mit den Verheißungen und Orientierungen Gottes: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet…“ (Mi 6,8). Eine solche Moral bringt Gott ins Spiel und seine Gebote, in denen sich das Interesse Gottes an unserem Heil manifestiert. „Aus deinen Befehlen gewinne ich Einsicht … Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, / ein Licht für meine Pfade.“ (Ps 119,103-104).
Dass Bischöfe das Spiel einer „neuen Sexualmoral“ mitspielen, ist beschämend. Fast ist man versucht zu sagen: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Gerade werfen sie das Los und verteilen, was ihnen nicht gehört: das ethische Kleid der Kirche.
___________________________
Von Bernhard Meuser
Jahrgang 1953, ist Theologe, Publizist und renommierter Autor zahlreicher Bestseller (u.a. „Christ sein für Einsteiger“, „Beten, eine Sehnsucht“, „Sternstunden“). Er war Initiator und Mitautor des 2011 erschienenen Jugendkatechismus „Youcat“. In seinem Buch „Freie Liebe – Über neue Sexualmoral“ (Fontis Verlag 2020), formuliert er Ecksteine für eine wirklich erneuerte Sexualmoral.
Diesen Beitrag als Druckversion herunterladen unter diesem Link