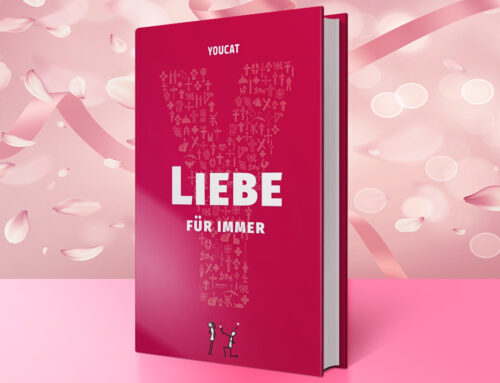Die Serie der Auslegung des Sonntagsevangeliums durch Dr. Martin Brüske geht weiter.
Lazarus
Auslegung des Evangeliums vom 26. Sonntag im Jahreskreis C Lk 19, 19-31
Moses und die Propheten: Die Weisung Gottes macht aufmerksam für Gott und für den Nächsten, für die Not gleich vor der Tür unseres Hauses. Ohne das Leben aus dieser Weisung werden wir blind sogar für den, der auferstanden ist von den Toten. Die Geschichte vom armen Lazarus führt von hier ins Jenseits, um diesseits Licht für unsere Gegenwart zu sein.
Gott hilf!
Lazarus – Eleazar – Gott hilf! – Gotthilf: So heißt der Arme in unserer Geschichte. Und in der Tat: Ihm kann nur noch Gott helfen! Jedenfalls hat er einen Namen – und erweisen wird sich, dass er ihn von Gott her und auf Gott hin hat. Abgelegt wird der Gelähmte (wieder einmal ist das griechische Original deutlicher als unsere Übersetzung: „hingeworfen vor sein Tor“ heißt es wörtlich) täglich vor der Tür eines namenlosen Reichen. Weil er vollkommen hilflos ist, lecken die Hunde seine Geschwüre, Folgen von Krankheit, Verletzungen oder Prügel.
Dem gegenüber steht der Reiche ohne Namen, dessen Luxusexistenz sich in Kleidung (Purpur ist der teuerste Farbstoff der Antike und das Leinen ist Byssos, die absolute Oberklasse des edlen Tuchs) und Lebensstil – täglich rauschende Partys – fast schon karikaturhaft ausdrückt. Er ist die eigentliche Hauptfigur. Denn er wird den Dialog mit Abraham über den Abgrund hinweg führen.
Eine Meistererzählung
Wir alle kennen diese Erzählung natürlich. Der „arme Lazarus“ (übrigens kommt das Wort Lazarett daher) und „Abrahams Schoß“ sind sprichwörtlich. Aber gerade, wenn man so eine biblische Geschichte gut zu kennen meint, lohnt es sich oft, noch einmal ganz genau hinzuhören. Denn wieder bietet uns der göttliche Erzähler eine Meistergeschichte, die viel mehr ist als bloß eine Erzählung über die Umkehrung aller Verhältnisse durch ausgleichende Gerechtigkeit – -Erste die Letzte, Letzte die Erste werden – im Jenseits. Das auch. Aber das ist eine Menschheitsahnung und eine Menschheitshoffnung, für die es Beispiele aus vielen Kulturen gibt – und in manchen Zügen gleichen Erzählungen, die das entfalten, unserem Evangelium. Jesus greift hier also etwas auf, dem er allerdings eine sehr besondere Wendung gibt. Und es lohnt sich, dem nachzuspüren!
Blindheit
Schon der Auftakt der Erzählung, die Exposition, ist in der Ökonomie der Mittel unglaublich meisterlich. Wie konnte Jesus erzählen! Drei Dinge werden kombiniert: Der denkbar größte Kontrast, die denkbar größte räumliche Nähe und ein dennoch – allerdings nur scheinbar! – unüberwindlicher Graben.
Wie schon angedeutet: Der sichtbare soziale Kontrast zwischen Lazarus und dem im Luxus schwelgenden reichen „Prasser“ (wie er traditionell genannt wird) ist fast schon karikaturartig überzeichnet. Hilflose, ausgelieferte, durch Krankheit und Hunger gezeichnete absolute Armut auf der einen Seite, hemmungslose Selbstdarstellung von luxuriösem Wohlleben andererseits. Man darf innerhalb des Lukasevangeliums hier an die Wünsche des reichen Kornbauern erinnern, die durch den plötzlichen Tod durchgestrichen werden und seine Planung als Narretei erscheinen lassen:
„Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut!“ (Lk 12, 19b).
Dem extremen sozialen Kontrast entspricht eine ebensolche räumliche Nähe: Lazarus befindet sich geradezu im Sichtbereich des reichen Prassers!
Aber dennoch ist da ein unüberwindlicher Graben. Oder genauer gesagt: Ein nicht zu überwindendes Tor zum Anwesen des Reichen. Von dort führt scheinbar kein Weg zum Armen nach draußen. Nur die ungestillten Hungerphantasien des armen Lazarus führen von draußen nach drinnen. Er wünscht sich, das Brot essen zu dürfen, das zum Reinigen der Hände dient und dann hingeworfen wird (vgl. die Antwort der Syrophönizierin an Jesus über die Brotkrumen für die Hündlein). Angesichts dieser Hungerphantasie wirkt sein Ausschluss und seine Marginalisierung in der unmittelbaren räumlichen Nähe, in Sichtweite, um so grausamer. Statt Brot kommen die Hunde und lecken seine Geschwüre.
Aber natürlich ist nur für Lazarus der Graben in Wahrheit unüberwindlich. Der Reiche ist einfach blind für die Wirklichkeit der Not. In seiner Lebensform kreist er ausschließlich um sich selbst. Später stellt sich heraus: Er kannte den Namen des Lazarus sehr wohl. Das heißt: Er wollte Lazarus nicht sehen!
Seitenwechsel im Tod
Der Moment des Todes lässt die Lebenslinien des armen Lazarus und des reichen Prassers konvergieren. Der Tod trifft alles, was menschliches Antlitz trägt. Zumindest dieser Moment ist für alle gleich. Allerdings endet die unentrinnbare Gemeinsamkeit des Menschenschicksals auch genau mit diesem Moment des Todes. Vom Reichen wird noch seine Beerdigung berichtet. Es muss nicht ausgesprochen werden, dass sie prunkvoll war. Dass das von Lazarus nicht berichtet wird, ist im Blick auf seine Armut ebenso charakteristisch wie der – statt dessen – sofortige Übergang zu seinem jenseitigen Schicksal: Den Gelähmten tragen Engel und sie tragen ihn in Abrahams Schoß, an den Ort ewiger, vollkommener Geborgenheit. Lazarus ist angekommen. Sein Name ist wahr geworden: Gott hat geholfen, ihm, dessen Name seine einzige Hoffnung war, denn eine andere hatte er nicht. (Allerdings wird von der Frömmigkeit des Lazarus nie ausdrücklich gesprochen. Und er ist ganz still, er sagt kein Wort. Nur seine Hungerphantasie redet von seinem Inneren.) Ja, Lazarus ist angekommen, er ist nicht mehr „draußen vor der Tür“: Er hat die Seite gewechselt – in den Lebensbereich Gottes, in seine Ruhe.
Auch der „reiche Prasser“ hat die Seite gewechselt. Seine stumpfe, selbstfixierte, blinde Unempfindlichkeit für die Not des Lazarus hat sich in schreckliche, qualvolle Isolation verwandelt. Es wird offenbar, was er gewesen ist und wozu er sich selbst bestimmt hat. Diesen Ort hat er selbst gewählt: Er ist jetzt „draußen“ – außerhalb des Lebensbereichs Gottes.
Ewigkeit und Zeit
Scheinbar haben wir es mit einem vollkommen symmetrischen Seitenwechsel von Lazarus und dem „Prasser“ zu tun. (So entspricht der flehentliche Wunsch des Prassers nach Benetzung seiner Zunge durch den Finger des Lazarus dessen vorheriger Hungerphantasie). Tatsächlich aber hat sich Zeit in Ewigkeit gewandelt. Der Dialog des Prassers mit Abraham entfaltet genau diese Wandlung: Was Lazarus und dem Prasser widerfährt, verewigt ihren wahren, tiefen Zustand in der Zeit. Lazarus war jedenfalls – wieso erfahren wir nicht – fähig, in die Ruhe Gottes einzugehen. Der „reiche Prasser“ war in seiner Fixierung auf sich selbst „arm“ (im schlechten Sinn) vor Gott. Diese Essenz der getanen Freiheit ist nun ewig geworden. Das ist sein Zustand. Der von Lazarus her unüberwindbare Graben zwischen drinnen und draußen wäre jederzeit überwindbar gewesen durch die Tat der Barmherzigkeit. Verewigt ist er unüberwindbar und in seiner Ausrichtung auf bloß endliche Güter hat der Reiche bekommen, was er wollte.
Auch dies erinnert wieder an das Gleichnis vom reichen Kornbauern und nicht zuletzt an den Weheruf über die Reichen aus der Feldpredigt des Lukas:
„Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.“ (Lk 12, 20-21).
„Aber dagegen: Weh euch Reichen; denn ihr habt euren Trost schon gehabt.“ (Lk 6, 24).
Moses und die Propheten
Nachdem der Prasser verstanden hat, dass sein Zustand endgültig ist, wendet sich der Dialog mit Abraham noch einmal auf eine überraschende Weise – und damit findet die Erzählung Jesu erst ihr eigentliches und eigentümliches Ziel. Wir kehren sozusagen aus dem Jenseits in unser Hier und Heute zurück. Der Prasser versucht nun zugunsten seiner Familie zu verhandeln. Wenn Abraham den Lazarus schon nicht zu ihm über den großen Graben schicken kann, dann doch wenigstens zu seinen Brüdern, um sie zu warnen, dass sie umkehren (deutlich wird hier auch, dass auch für ihn Umkehr notwendig gewesen wäre). Übrigens fällt auf, dass der „reiche Prasser“ sich immer noch für sozial übergeordnet hält, wenn er Abraham auffordert, ihn zu Dienstleistungen für ihn oder seine Familie zu bestimmen. Das ist ein sehr subtiler Hinweis, dass sich tatsächlich seine falsche Haltung verewigt hat (was Jesus meisterlich in diesen Erzählzug umsetzt). Einer von den Toten soll also erscheinen. Aber Abraham – der übrigens die ganze Zeit in großer Sanftmut redet – verweist auf Moses und die Propheten, also auf Gottes Weisung und ihre immer neue Aktualisierung in prophetischer Rede. Der Sinn: Kein noch so sensationelles oder übernatürliches Ereignis nützt. Wir bleiben blind auch gegen das Handeln Gottes, wenn wir im Sinne von Gottes- und Nächstenliebe, im Sinne einer Barmherzigkeit, die sich berühren und bewegen lässt, stumpf, blind, unbewegt bleiben. Nicht einmal Jesu Auferstehung von den Toten.
Dr. theol. Martin Brüske,
geb. 1964 im Rheinland, Studium der Theologie und Philosophie in Bonn, Jerusalem und München. Lange Lehrtätigkeit in Dogmatik und theologischer Propädeutik in Freiburg / Schweiz. Unterrichtet jetzt Ethik am TDS Aarau. Martin Brüske ist Mitherausgeber des Buches “Urworte des Evangeliums”.