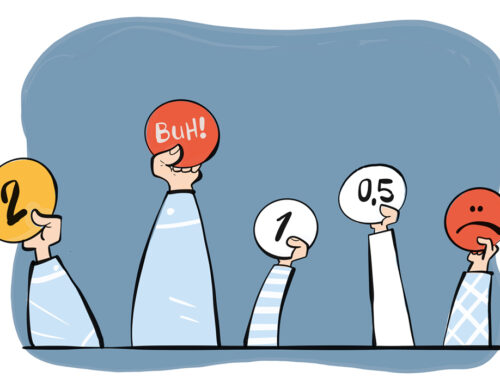In einem Gastbeitrag (hier auch als Druckversion) analysierte der Theologe Edmund Pevensie die geistige Großwetterlage der Katholischen Kirche in Deutschland als Resultat einer bereits erfolgten Kernspaltung. Laut seiner messerscharfer Analyse ist das Schisma nicht nur „unausweichlich“, die universalkirchlichen Kräfte in Deutschland sollten es in seinen Augen gar bewusst anstreben und gestalten.
Wir stellen als Initiative Neuer Anfang diese pointierte, wenn auch sicher nicht leichte Lektüre, die das Ensemble der „Meisterdenker“ hinter dem Synodalen Weg präzise frei-, aber auch die grundstürzenden Konsequenzen deutlich offenlegt, zur Diskussion. Denn es geht beim Synodalen Weg nicht um theologische Einzelfragen, sondern um das Verständnis des Christentums schlechthin und um die Identität der Kirche selbst. Es geht im Grunde um zwei Religionen, die inkompatibel sind und sich in ihren letzten Annahmen hart und unvermittelbar im Raum stoßen und jedem Beschwichtigungsbluff standhalten.
Der Autor wählt mit Edmund Pevensie ein Pseudonym, wie einst auch Ignaz von Döllinger seine Kritik am Ersten Vatikanum unter dem Decknamen „Quirinus“ veröffentlichte. Die Hintergründe sind bitter. Der Autor, der uns bekannt ist, steht irgendwo in Deutschland im kirchlichen Dienst. Würde er seine scharfsinnig, aber strikt sachlich formulierte Kritik unter eigenem Namen veröffentlichen, müsste er damit rechnen, sanktioniert zu werden.
Der Synodale Weg behauptet, er wolle eine angstfreie Kirche. Tatsächlich hat er selbst ebenfalls Druck und Angst erzeugt, was zahlreiche Zuschriften an uns belegen könnten – und natürlich wissen das die dort handelnden Protagonisten auch selbst.
Wieso die Erzeugung von Angst leider mit zur Logik der Sache gehört, können Sie ebenfalls im folgenden Text erfahren. Eines kann vielleicht doch verraten werden über die Wahl dieses Pseudonyms: Der Autor ist selbst auf intensivste Weisen durch die verschiedenen Denkschulen gegangen, die er als Tiefengrammatik des Synodalen Wegs beschreibt. Er weiß, wovon er redet.
1. Realitätsgewinne
Betrachtet man die Reaktionen auf den Artikel von Magnus Striet „Nehme den Brief zum Synodalen Weg intellektuell nicht allzu ernst“, erschienen als „Gastbeitrag“ bei katholisch.de, der offiziellen Medienseite der Deutschen Bischofskonferenz, kann man den Eindruck gewinnen, dass sich nicht wenige Kontrahenten zugleich irgendwie erleichtert zeigen. Erleichtert, weil hier von einem der Hauptprotagonisten des Synodalen Weges, der seit längerem als eine der wichtigsten theologischen Referenzquellen vieler deutscher Bischöfe gilt und kirchenpolitisch ausgesprochen agil ist, endlich offen ausgesprochen wurde, was bislang – besonders von neokonservativer Seite – thematisch nahezu tabuisiert wurde: dass nämlich das Schisma, auch wenn es noch nicht förmlich vollzogen wurde, in der Sache längst existiert („Es gibt das Schisma längst“). Damit meint Striet, dass es eine faktische Spaltung dogmatischer und moraltheologischer Positionen in der katholischen Kirche in Deutschland, aber sicher auch auf weltkirchlicher Ebene gibt, die logisch nicht mehr vermittelbar sind. Davon sprachen sonst vorrangig Vertreter des traditionalistischen Lagers, die, wie etwa Roberto de Mattei oder Martin Mosebach, seit geraumer Zeit thematisieren, dass sich in der nur noch äußerlich einen Kirche zwei einander immer unversöhnlicher gegenüberstehende Kirchen herausgebildet hätten.
Das Verdienst, diese Spaltung sichtbar zu machen, kommt ebenso dem Synodalen Weg im ganzen zu, der sie zwar vorantreibt, aber keineswegs erst etabliert. Ineins mit den gegenläufigen theologischen Auffassungen macht er zugleich deutlich, dass es sich bei dieser Debatte längst nicht mehr um einen gepflegten akademischen oder geistlichen Diskurs handelt. Bischof Voderholzer hat bereits vor Jahren im Blick auf den Synodalen Weg angemerkt, nicht mehr erkennen zu können, „dass die Voraussetzungen für einen echten „Dialog“ gegeben sind. Es fehlt m.E. eine von allen Beteiligten anerkannte theologische Hermeneutik und die Bejahung der Prinzipien der katholischen Glaubensbegründung, die eine Berufung auf Schrift, Tradition, Lehramt und Konzilien etc. als stärkste Argumente gelten lässt.“[1]
Dass aber unter dieser Voraussetzung der Widerstreit – sofern man sich nicht trennt – ab einem bestimmten Punkt in einen bloßen Machtkampf mit all den bekannten politischen Ranküren umschlagen muß, hat das jüngst zu Ende gegangene vierte Frankfurter Synodalereignis prächtig demonstriert. Das, was wir aktuell erleben, war antizipierbar, es besitzt eine innere Logik, die von den Verantwortungsträgern in der Kirche im Grunde seit Jahrzehnten verdrängt worden ist. Und nun werden wir, ob wir das wollen oder nicht, mit einem Konflikt überzogen, in dem es um nichts anderes mehr als die blanke Vernichtung des Gegners geht. Wie Birgit Kelle im Blick auf das irritierende Unterwürfigkeitsverhalten etlicher Bischöfe sagt: Sie müssen wissen, dass sie sich in einem Angriffskrieg befinden[2].
2. Selbstermächtigung
Die Absicht des Synodalen Weges richtet sich bei weitem nicht nur auf die Aufarbeitung der Mißbrauchsfrage. Die Agenda ist vielmehr grundstürzend, sie besitzt eine philosophische Tiefengrammatik, und um die geht es mir zunächst und vor allem. Nur innerhalb dieses philosophischen Horizontes wird verständlich, warum von diesen Leuten und den flankierenden theologischen Stimmen etwa Magnus Striets, Eberhard Schockenhoffs, Julia Knops, Johanna Rahners oder Gregor Maria Hoffs die Zeitgemäßheit, also der soziokulturelle Horizont der späten Moderne, für alle theologischen, besonders für die ethischen Verständnisse normativ sein soll und die bisherige kirchliche Widerständigkeit gegen die herrschenden Paradigmen radikaler individueller Selbstbestimmung und entsprechend pluralistischer Lebensstile als borniert gilt. Das ist ja nicht unmittelbar evident.
Evident ist allerdings, dass wir es hier mit einem massiven Affekt zu tun haben, den man wohl auch Ressentiment nennen könnte, und die Akteure auf dem Synodalen Weg ihren sie leitenden „libertarischen“ Freiheitsbegriff gleich selber zur politischen Realität werden lassen. Das, so scheint mir, ist in diesem Zusammenhang auch das eigentlich Zu-Bedenkende: Wir begegnen bloßen Willenssetzungen. An dieser Stelle taucht nichts Geringeres als der große geistesgeschichtlichen Kontext auf, in den wir hineingestellt sind und dessen ungeheurer Dimension wir entsprechen müssen. Es ist, da wird man Striet völlig zustimmen können, das Projekt der Moderne selber, um dessen Einschätzung und Bewältigung es geht. Dieses Projekt, zu dessen spätmodernen Manifestationen auch der Synodale Weg zählt, ist seit mindestens drei Jahrhunderten unterwegs und reicht in zentralen Aspekten bis in den spätmittelalterlichen Nominalismus zurück[3].
Jedem seine eigene Freiheit?
Der Kern des libertarischen Freiheitsbegriffs besteht nämlich gerade darin, dass sich die Freiheit nunmehr ihren Inhalt selber geben können soll. Damit ist sie nicht nur, wie Thomas Pröpper zutreffend betont hat[4], unter formaler Rücksicht unbedingt, sofern die Gründe für unser Handeln tatsächlich nie die – im bloßen Willen selber liegende – Ursache desselben sind. Vielmehr avanciert sie auch in dem Sinne zu einer absoluten Größe, dass sie nicht mehr als an eine metaphysisch und selbst biologisch verstandene menschliche Natur, die eine unverfügbare teleologische Verfassung besitzt, zurückgebunden gedacht wird. Da sie damit zu einer normativen Letztinstanz wird, die aus sich selbst die Legitimität ihrer eigenen Handlungsmaximen bestimmt, verschwindet die alte moraltheologische Unterscheidung zwischen dem persönlichen Gewissen, das die höchste subjektiv-moralische Instanz ist, und den objektiven Normen, die das Gewissen zwar in der Güterabwägung als des gewöhnlichen Falles unserer sittlichen Urteilsbildung auf konkrete Situationen applizieren muß, die es aber als solche nie aus sich selbst haben kann, sondern als Naturrecht und göttliches Offenbarungsgesetz vorfindet.
Limitiert wird die libertarische Freiheit nur noch, um nicht selbstwidersprüchlich zu werden, durch den Respekt vor der Freiheit des je anderen Subjekts bzw. die entsprechend verstandene Selbstzweckformel Kants. Allerdings konstatiert Karl-Heinz Menke zu Recht, dass auch das, „was diese Anerkennung genau bedeutet, von keiner äußeren Instanz wie Natur, Heilige Schrift oder Lehramt bestimmt wird“[5].
So lässt dieser Freiheitsbegriff prinzipiell „nur gelten, was dem je eigenen subjektiven und vermeintlich aufgeklärten Bewußtsein und der autonomen Vernunft einleuchtet. Alles andere wird als theologisch „substanzlos“ … weggewischt“, so Bischof Voderholzer[6].
Die auch den Synodalen Weg imprägnierende Programmatik richtet sich grundlegend gegen eine bestimmte metaphysische Ontologie. Die moraltheoretischen und ekklesiologischen Postulate des Synodalen Weges sind, wenngleich sie im Aufmerksamkeitsfokus stehen, nur Implikate einer „Revolution der Denkungsart“, die das Verständnis des Seins der Seienden selber und damit auch des Wesens des Menschen betrifft. Der Streit, der mitsamt seinen ganzen Folgeerscheinungen mittlerweile auch die katholische Kirche in bürgerkriegsartige Verhältnisse stürzt, ist letztlich und entscheidender Weise der Konflikt zwischen zwei fundamental verschiedenen Philosophien. Dieser Grundkonflikt durchzieht auch die Debatte zwischen Striet und Menke, in der Menke von Striet immerhin die Erkenntnis attestiert wird, „wo der eigentliche Knackpunkt liegt“, nämlich in „der Frage des Verhältnisses von Freiheit und Wahrheit“[7].
Der Mensch als Maß aller Dinge
Die alles entscheidende Weichenstellung wird von Eberhard Jüngel als die durch die Neuzeit geschehende spezifische Adaption des berühmten Satzes des Protagoras, der Mensch sei das Maß aller Dinge, identifiziert: „Daß der Mensch das Maß aller Dinge sei, ist eine zwar noch immer kühne, aber doch schon sehr früh gewagte Behauptung. Man kann sie bejahen oder verneinen. Daß der Mensch sich zum Maß aller Dinge macht, ist hingegen eine das Wesen der Neuzeit charakterisierende Feststellung. Sie läßt sich nicht verneinen. Denn darin, daß er sich zum Maß aller Dinge macht, ist er der neuzeitliche Mensch.“[8]
Damit hat sich die von Protagoras vorgenommene Bestimmung des Menschen fundamental verändert. Findet sich der Mensch dort als das Maß aller Dinge immer schon seinsmäßig vor, konstituiert er jetzt diese Position selber. Denn die Selbstermächtigung bedeutet, dass sich der Mensch nicht mehr als ein – wenngleich ausgezeichnetes – Seiendes im Zusammenhang der Seienden im ganzen versteht, sondern exklusiv den Seienden maßgebend gegenübersteht. Ausgezeichnet war der Mensch im alten Sinne dadurch, dass er die Seienden in deren jeweiliger Wesensverfassung erkennen kann, so dass die Seienden allein in ihm zu sich selber, ihrer Wahrheit, finden. Mitnichten war der Mensch in diesem Verständnis den Seienden gegenüber maß-gebend, sondern bildete umgekehrt den privilegierten Ort, an dem sich das Maß, das die Dinge in sich selbst tragen, erst zeigen kann. Insofern wurden die Seienden so verstanden, daß sie in einem fundamentalen apriorischen Bezug zum Menschen stehen – wie auch der Mensch auf das Sein der Seienden verwiesen ist.
Eben dieser wechselseitige Bezug wird im Projekt der Moderne aufgelöst. Es geht jetzt im Paradigma der Selbstermächtigung des Menschen zum Maß aller Dinge um eine Macht, die sich nicht mehr von einem Außerhalb ihrer selbst empfängt und so auch jedes Maß außerhalb ihrer selbst verloren hat. Das Maß der Dinge kann daher nur die sich aus sich selbst beziehende Macht des Subjektes sein. Das ontologische Eigensein der Dinge verschwindet in der Macht des sich zum Maß aller Dinge ermächtigenden Subjekts, dessen „Wille zur Macht“ nun zum Sein der Dinge selber wird. Das hat Heidegger in seiner Nietzscheinterpretation genial beschrieben[9]. Es gibt kein Vorgefundenes mehr, das die Macht begrenzte. Die Maßlosigkeit einer sich absolut setzenden Macht wird zum Signum der neuen Zeit.
Ob die These Hans Blumenbergs in seinem Werk „Die Legitimität der Neuzeit“ stimmt, dass die Neuzeit keine Säkularisierung des Christentums sei, sondern deren Ur-Impuls der Hinwendung zu den sich autonomisierenden, natürlichen Kräften des Menschen als Abwendung vom nominalistischen Verständnis göttlicher Allmacht geschah, die in ihrem Irrationalismus als unerträglich empfunden wurde, sei hier dahingestellt. Wolfhart Pannenberg hat sie meines Erachtens mit guten Gründen infrage gestellt[10]. Bemerkenswert scheint mir indes, dass sich die Aufspreizung des Menschen zu einer sich selbst zum Maß aller Dinge machenden Herrschaftssubjektivität progressiv – wie man bereits in der Renaissance sieht – als Usurpation der klassischen Gottesattribute der Allwissenheit und Allmacht realisiert. Und sofern diese Subjektivität schließlich ihren eigenen Willen nur noch durch ihn selbst legitimiert, beginnt sie selber die absolutistischen Züge des nominalistischen Gottes zu tragen.
Achsenverschiebung in der Moderne
Die geschilderte Achsenverschiebung führt indes dazu, dass der Mensch unter dem zu leiden beginnt, was der Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter den neuzeitlichen „Gotteskomplex“ genannt hat[11]. Wie jedes narzisstische Leiden hat auch dieser Komplex eine Reihe unbekömmlicher Folgen. In erster Konsequenz wird der Mensch zu einer Zerrform göttlicher Transzendenz, zu einer eigentümlich weltenthobenen Subjektivität, die nicht mehr intrinsisch in den Zusammenhang der endlichen Seienden gehört. Unter dieser Rücksicht ist Martin Heideggers Kritik an der gewöhnlichen Säkularisierungsrede völlig berechtigt: Der neuzeitliche Mensch wird gerade nicht weltbezogener; vielmehr verliert er die Welt, die Offenbarkeit der Seienden, die sich ihm nun verbirgt. Schon bei Descartes ist der Mensch als res cogitans selbst mit seiner eigenen Leiblichkeit, der res extensa, nur oberflächlich verbunden. Als das exklusive subjectum, das einzig allen Dingen Zugrundeliegende, depotenziert das neuzeitliche Subjekt die Dinge sowohl erkenntnistheoretisch als auch ontologisch zu seinen bloßen Objekten. Diese Art der Objektivierung ist die entscheidende Ermöglichungsbedingung totaler Macht.
Mit dem sich zum Maß aller Dinge ermächtigenden Menschen ist in der Sache eine Dynamik eröffnet, in der das Sein der Seienden schließlich nurmehr als Verfügungsmasse begriffen wird[12]. Heidegger nennt dies die „Machenschaft“, die er als das Wesen der modernen „Technik“ beschreibt. Als „Ge-stell“ betreibt sie die Verdinglichung von allem zu bloßen Bestandsstücken des Bestandes, die dem Herrschaftszugriff beständig zugänglich sind. Ein Ding zu erkennen, heißt deshalb schon bei Francis Bacon, zu erkennen, was ich mit ihm machen kann, wenn ich es habe. Dazu muß jede teleologische Betrachtung der Dinge, die auf die eigenen, inneren Zweckbestimmungen der Seienden rekurriert, als unwissenschaftlich eliminiert werden und einer bloß wirkursächlichen Rekonstruktion weichen (Robert Spaemann)[13]. Nur vor dem Hintergrund dieser philosophischen Achsenverschiebung wird verständlich, dass die technisch-naturwissenschaftliche Rationalität zum Leitparadigma von Erkenntnis überhaupt avancieren konnte.
Freiheit als Gegensatz zur Wahrheit
Im Projekt der Moderne liegt die Neigung zur Überwindung überhaupt aller qualitativen Differenzen. Das kommt heute zu seinem radikalen Austrag. Immer unverfrorener betreibt das moderne Bewußtsein einen planetarisch ausgreifenden ontologischen Egalitarismus, in dem partikulare Identitäten natürlich-substantieller oder historisch-gewachsener Art nivelliert werden. Völker, Nationen, Sitten, Vaterländer, Muttersprachen, ja Mutter- und Vaterschaft als solche, Heimaten, Religionen, sämtliche Traditionen, Zeiten und Räume, Personen, Privatheiten, Geheimnisse und Einsamkeiten, aber ebenso Körper, Geschlechter, natürliche Arten – sie alle werden vom gigantischen Strudel dieses Mahlstromes verschlungen, sei es, dass sie gleich in radice annihiliert oder doch durch Ineinanderüberführung und Neuzusammensetzung beliebig transformiert oder zu wissenschaftlich und politisch eingehegten, quasimusealen Relikten depotenziert werden.
Dieser hier nur in groben Umrissen skizzierbare Horizont des modernen Bewusstseins ist nun im Modus der spätmodernen, radikal individualistisch gewendeten Adaption der aufklärerischen Autonomiekategorie auch für den Synodalen Weg bestimmend geworden. Als diese Adaption steht der libertarische Freiheitsbegriff, dessen theologische Vertreter wie Magnus Striet oder Saskia Wendel sich hier nur in Nuancen unterscheiden, allerdings weit näher beim französischen Dekonstruktivismus als bei Kant, für den die allein Autonomie besitzende Vernunft die Individuen mit deren „selbstsüchtigen thierischen Neigungen“ in ein strenges Pflichtregime einspannt – um sie gegen ihre egozentrischen Begehrlichkeiten der vernünftigen Allgemeinheit zu unterwerfen. Die individualistische Lesart der Autonomiekategorie, die für die Spätmoderne charakteristisch ist, ist mit der Ethik Kants nicht zu machen. Was Kant zur „humanwissenschaftlich“ aufgehübschten Lustemphase des Synodalen Weges und den entsprechenden Auffassungen Eberhard Schockenhoffs, die jetzt auch den deutschen Bischöfe mehrheitlich einleuchten, angemerkt hätte, läßt sich unschwer antizipieren[14].
Dass dem Leser aus den Texten des Synodalen Weges vor allem Michel Foucault und Judith Butler entgegenwinken, indiziert das Ausmaß, mit dem der Geist der Machenschaft nun selbst die katholische Kirche zu kolonialisieren vermocht hat. Wie konsequent die Überwindung aller Substantialitäten, die dem entgrenzten individuellen Willen entgegenstehen könnten, von Foucault und Butler betrieben wird und wie radikal der hier aufscheinende Nihilismus ist, kann man hervorragend an zwei Texten erkennen, die den Bischöfen zur Lektüre dringend empfohlen werden müßten: „Sex, Macht und die Politik der Identität“ von Michel Foucault sowie „Performative Akte und Geschlechterkonstitution“ von Judith Butler [15].
Freiheit wird hier im systematischen Gegensatz zur Kategorie der Wahrheit verstanden. Inkriminiert wird nicht der Begriff der Wahrheit als bloße Richtigkeit von Aussagen. Vielmehr wird jenes Verständnis von Wahrheit abgelehnt, die – nenne man sie mit der hochmittelalterlichen Philosophie „transzendentale Wahrheit“ oder selbst noch mit Heidegger die „Offenbarkeit des Seins“ – den Dingen an sich selber unverlierbar zukommt und die von uns grundlegend vernommen werden muß. Es ist einigermaßen leicht, die Rede vom Naturrecht lächerlich zu machen, aber basal bezieht sie sich auf diesen Seins-Gehorsam, in dem sich gerade die Freiheit als Sein-lassen der Wahrheit der Seienden realisiert. Wird dieser Gehorsam abgeschafft, indem sich der Mensch – wie der späte Foucault ganz neuzeitlich formuliert – zum maßgebenden „Herr-Subjekt“ macht, verlieren die Seienden ihre Sprache und wir mit unserem Gehör für deren Wesenszuspruch auch uns selbst.
3. Seinsvergessenheit
Signifikanterweise betrieb Kant seine „Kritik der reinen Vernunft“ in der Absicht, die naturwissenschaftlich-mathematische Beschreibung der Dinge sicherzustellen. Dazu müssen die Gegenstände immer schon nach den Bedingungen des Verstandes als unsere Objekte konstituiert sein, so dass der Verstand in der Objekterkenntnis stets auf sich selbst, seine universalen Anordnungen, trifft. Das „Ding an sich“, das Kant allerdings noch annimmt und von Nietzsche als Überrest jenes „alten Theologenvorurteils“ verspottet wurde, wonach es eine persistierende prädiskursive Sphäre, ein mit sich identisch bleibendes Sein der Seienden gibt, ist für unsere Vernunft in die völlige Unerreichbarkeit verschwunden.
Wären wir darauf angewiesen, dass sich die Dinge von sich selbst her in ihrem Sein erst unserem Geist zeigen müssen, der auf diese Selbstoffenbarung hinnehmend reagiert und die Dinge in deren eigener Wahrheit aufscheinen läßt, könnten sich die Dinge unserem Zugriff nicht nur entziehen, sondern blieben prinzipiell in ihrem Wesen unverfügbar. Wie Heidegger in den „Bremer Vorträgen“ sagt: Der vormoderne Bauer züchtete den Zugstier zwar für dessen Verwendung, aber es war doch der Stier selber, der sich in seine Verwendung wandte, um sich nach seiner Verwendung wieder in das Eigene zu wenden[16]. Mit derartigen Grenzen, die aus dem Wesensgrund der Seienden selber stammen, kommt der neuzeitliche Mensch aber nicht mehr zurecht.
Foucault meinte, wir dürften uns nicht einbilden, dass die Welt uns ein lesbares Gesicht zuwende. Striet redet ganz ähnlich. Dieser radikale Erkenntnisskeptizismus, den Hegel im Übrigen in der „Phänomenologie des Geistes“ perfekt kritisiert hat[17], ist für den libertarischen Freiheitsbegriff essentiell. Denn erst die Auflösung der inneren Zusammengehörigkeit von Vernunft und Sein läßt an die Stelle der von uns sowohl vernehmbaren als auch uns bindenden Wahrheit der Dinge den „Diskurs“ und damit die ungebremste Macht der Machenschaftlichkeit treten. „Interpretationen“ heißt das bei Striet, die die „Naturrechtsfantasien“ ersetzen. Zwar reklamiert Striet, der wie Habermas Wahrheitsansprüche zu bloßen Geltungsansprüchen depotenziert, permanent die Verpflichtung, „Gründe“ für die Interpretationen anzugeben, d.h. zu argumentieren. Man fragt sich allerdings, was diese sich diskursiv zu bewährenden Gründe noch für eine Validität besitzen, wenn sie sich, was apriori ausgemacht ist, auf keine metaphysische Natur der Dinge mehr beziehen dürfen. Wenn alle Überzeugungen ohnehin nur den epistemischen Status historisch bedingter und genealogisch entsprechend entlarvbarer Setzungen besitzen, können auch die für sie angeführten Gründe nur von dieser Art sein: subjektive Evidenzen, Meinungen oder Geschmäcker, deren Geltung sich allein dem Konsens Gleichgesonnener verdankt, die in dem übereinstimmen, was ihre jeweiligen Freiheiten als inhaltlich wahr bestimmt haben – bis sie sich nicht mehr „bewähren“ und neuen Gültigkeiten weichen.
Zur Entwicklung dieser Position haben nicht nur Nietzsches Philosophie, sondern auch Kants Vernunftkritik ebenso wie der Vernunftbegriff Hegels, der die Dilemmata der kantischen Vernunfttheorie und das unerkennbare „Ding an sich“ überwinden wollte, um schließlich, wie Schelling kritisch anmerkte, sämtliche Seins-Bestimmungen zu bloßen Reflexionsbestimmungen zu verflüchtigen, Erhebliches beigetragen. Heideggers Auffassung, die Geschichte des Denkens des Seins sei die Geschichte des Seins selber, spielt hier ebenfalls eine bedeutende Rolle. Allerdings werden diese Philosophien in ihren spätmodernen Rezeptionen teilweise radikal modifiziert und auch vulgarisiert. In diesem Zusammenhang ist es besonders bedeutsam, dass – ähnlich wie in der Autonomiefrage – auch die Kantische Erkenntnistheorie im postmetaphysisch-dekonstruktivistischen Paradigma verändert wird, und zwar dahingehend, dass nun die jeweils zeitgeschichtlich herrschenden Begriffe und Kategorien für die Subjekte zu den Konstitutionsmechanismen der „Welt“ schlechthin werden. Sie ersetzen als der „Diskurs“ jene Begriffe und Kategorien, die nach Kant immerhin noch im Verstand jedes Menschen universal und immer vorhanden sind und so die einheitliche Objektwelt ermöglichen.
Der christliche Offenbarungsglaube implodiert
In theologischer Wendung heißt der diskurstheoretische Ansatz konsequenterweise für den Synodalen Weg, dass die Kirche genötigt ist, ihren Glauben in den jeweils herrschenden soziokulturellen Schemata auslegen und damit beständig neu erfinden zu müssen. Sie werden zu jenen „Zeichen der Zeit“, die in Wahrheit nicht – wie etwa Kardinal Kasper und Bischof Voderholzer in ihrer Kritik des Synodalen Weges freundlicherweise noch annehmen – zu einem bloß weiteren Ort der Offenbarung Gottes neben Schrift und Tradition, sondern vielmehr zu den Verständnismaßgaben schlechthin avancieren. Die Dimension der Wahrheit verschwindet ja in unsere wechselnden diskursiven Setzungen und Übereinkünfte, zu denen es kein Jenseits mehr gibt, sie sind für uns die alleinige epistemische Realität.
Deswegen sind nach Striet nicht nur alle lehramtlichen Aussagen, sofern deren kirchlich reklamierter Wahrheitsstatus auf den der bloßen Geltung reduziert werden muß, prinzipiell reversibel, auch die Aussagen des biblischen Jesus von Nazareth unterfallen diesem epistemischen Prinzip. Verläßlich ist hier nur noch, dass nichts mehr verlässlich ist. Würde dieser Ansatz zum kirchlichen Selbstverständnis, und erhebliche Teile der Kirche in der westlichen Hemisphäre drängen dorthin, implodierte der christliche Offenbarungsglaube und ließe der kirchliche Totalbankrott nicht lange auf sich warten.
In gewisser Weise ist das die Radikalität des Nominalismus, die Universen, in denen wir unterwegs sind, sind nur noch Produkte unserer sprachlichen Erfindungen. Wenn aber alle erfinden, einschließlich des „Juden Jesus“, der Bibel oder des kirchlichen Lehramtes, und selbst die metaphysische Kategorie einer ewigen Wahrheit oder seins-vernehmenden Vernunft eine bloß kontingente Machtsetzung ist, dann darf das Individuum, das diesen prinzipiell willkürlichen und alles im strengen Sinne vergleichgültigenden Zusammenhang durchschaut, ohne Skrupel seine eigenen Wahrheiten konstruieren. Und es darf ohne Skrupel versuchen, jene zu überwinden, die bislang den Großdiskurs beherrschten, indem sie die Erkenntnis der einzig verbliebenen Wahrheit tabuisierten, dass es keine objektiv verbindliche Wahrheit oder, was auf dasselbe hinausläuft, keine Erkenntnismöglichkeit derselben gibt. Zum Zweck dieser Selbstermächtigung wollte Foucault mit seinen Arbeiten zur „Subversion des Wissens“ den Individuen die theoretischen Instrumente, von ihm selber „Molotowcocktails“ genannt, bereitstellen.
Dass „die Freiheit das Eigentum des Geistes“ (Hegel) oder, wie Heidegger in seiner Wahrheitsschrift formuliert, das Wesen der Wahrheit die Freiheit sei (Freiheit als das Sein-lassen des sich ins Offene der Seienden frei-gebenden Seins), verändert sich im dekonstruktivistisch geprägten Kontext der Gegenwart zur Überzeugung, dass das Wesen der Freiheit die Macht – vor allem der Selbsterfindung – ist. „Macht“ ist bei Foucault ebenso wie bei Nietzsche keineswegs negativ konnotiert. Alles ist Macht. Es geht nach Foucault, und insofern versteht er sich als Aufklärer, nur darum, dies zu begreifen und damit zu verstehen, niemandem mehr für seine Selbstentwürfe Rechenschaft schuldig zu sein. Dazu kann durchaus der Suizid gehören. Bei einem Interview erklärte er, die Frage, warum sich jemand umgebracht habe, nerve ihn, es reiche doch, dass der Betreffende das einfach gewollt habe. Das ist der libertarische Freiheitsbegriff katexochen. Ethik verflüchtigt sich zur Formulierung von Klugheitsregeln für die best- und das heißt freiest mögliche Inszenierung des Subjekts als Kunstwerk seiner selbst, zu dessen Ästhetik auch die letztendliche Selbstzerstörung des Kunstwerks zählen kann.
Hass auf die Natur
Eine abschließende Bemerkung in diesem Zusammenhang. Der Selbst- und Weltverlust des unlimitierten Herr-Subjekt-Seins impliziert letztlich auch die Destruktion der Leiblichkeit als solcher. Das mag auf den ersten Blick nicht evident sein, da es ja im heutigen Sexualitätsverständnis als einem der prominenten Anwendungsfälle der Machenschaft zunächst um die freie Konstruierbarkeit sämtlicher sexueller Identitäten und damit um das Begehren, also um die Sphäre der Sinnlichkeit geht. Sie aus ihrem düsteren augustinischen Gulag zu befreien, schickte sich ja etwa auch Eberhard Schockenhoff an. Hinter den sozialen Repressionserfahrungen steht aber noch eine basalere Limitationserfahrung, und die bezieht sich auf die biologische Natur selber. Darauf hat schon Simone de Beauvoir reflektiert, die die weibliche Physis als solche für den zentralen Unterdrückungsmechanismus der Frau gehalten hat. Die heutige Wut vieler Vertreterinnen der Gendertheorie auf die Naturzwänge ist nahezu grenzenlos, und Camille Paglia, die in ihrem großartigen Werk „Masken der Sexualität“ zur Dekonstruktion des Dekonstruktivismus gerade die unhintergehbare Naturdimension (und damit auch Sigmund Freud) zur Geltung bringt, trifft gewissermaßen stellvertretend der geballte Naturhass der Butler-Schule.
Dieser Hass muss dazu führen, die technischen Möglichkeiten, die sich die moderne Herrschaftssubjektivität erworben hat, zur Manipulation des Körpers einzusetzen, um dessen eigene Gesetzmäßigkeiten progressiv zu brechen und dem Willen systematisch zu unterwerfen. Das hat mittlerweile bereits jene grausamen Dimensionen angenommen, die Birgit Kelle beschreibt [18]. Die Materie wird aber immer eine Restwiderständigkeit behalten. Daher hat die transsexuelle Aktivistin Martine Rothblatt konsequenterweise erklärt, die Transgenderbewegung sei lediglich „die Auffahrtrampe zur Überwindung des Fleisches“[19]. Das erhoffte Ziel ist eine von keinem Substrat mehr begrenzte Menschheit, und die soll in jener Verschmelzung des Menschen mit technologischen Implantaten bestehen, von denen die Theoretiker des Transhumanismus seit langem träumen. Hier käme das Heidegger’sche Ge-stell in seine letzte Radikalität. Wie weit sich diese Dystopie realisieren lassen können wird, sei dahingestellt. Erschütternd aber ist, dass sich der Synodale Weg hier nicht im Ansatz problembewußt zeigt und erkennt, dass er längst mit seiner LGBTQIA+-Agenda jenen die Hand reicht, die Agenten einer Verwüstung planetarischen Ausmaßes sind. „Etwas rast um den Erdball“[20] – und die katholische Kirche wird bereitwillig Teil des Verhängnisses.
Reformation 2.0
Mit dieser Machenschaft hat es beim Synodalen Weg indes nicht sein Bewenden, vielmehr wird mit großer Entschiedenheit über sämtliche Traditionsbestände der katholischen Kirche hergefallen. Alles ist zur Verfügungsmasse des sich zu sich ermächtigenden Willens geworden. Vor allem geht es neben den moral- und gendertheoretischen Fragen um das – zölibatäre – priesterliche bzw. bischöfliche Amt, das sich als Weiheamt per se nicht demokratisch begründen kann. Es ist in seinem Wesen als eine göttliche Vor-Gabe bestimmt, durch die sich innerhalb der Kirche als des Leibes Christi die bleibende Unterschiedenheit Christi als des Hauptes seines Leibes repräsentiert. Auch wenn es zwischen Christus selbst und seiner sakramentalen Selbstrepräsentation im priesterlichen Amt eine bleibende qualitative Differenz gibt, handelt im Unterschied zu allen anderen Gläubigen doch nur der Priester „in persona Christi capitis“, also nicht einfach nur „in persona Christi“, was etwa die mit ihrem Kind betende Mutter auch macht[21].
Zugleich begründen sich mit diesem spezifischen ontologischen Status – auf allerdings unterschiedlichen Verpflichtungsebenen – sowohl das exklusive Mannsein des Priesters als auch dessen zölibatäre Lebensform. Denn der fleischgewordene Logos ist, und zwar als die sakramentale Selbstrepräsentation des göttlichen Vaters, Mann, so dass diejenigen, die ihn wiederum in seiner Kirche sakramental repräsentieren, Männer sein müssen. Und wie Christus selber ehelos war, um den unbedingten soteriologischen Primat der väterlichen Gnade, also den allein von Gott erzeugten übernatürlichen Lebenszusammenhang, in seiner Existenzform darzustellen, ist es gerade für das sakramentale Amt zumindest in hohem Maße angemessen, diese Lebensform Christi zu übernehmen.
Argumentative Kurzschlüsse
Vom Synodalen Weg wird all dies teils als ein voraufgeklärter Phantasiekosmos und andernteils als patriarchale Machtsetzung dechiffriert. Für letztere Entlarvungen ist im synodalen Jobsharing Julia Knop die zuständige Spezialistin. Der französische Philosoph Jean-Claude Michéa nennt diese machttheoretische Reduktion ironisch ein „anwenderfreundliches Verfahren“, weil es erlaubt, sämtliche Positionen, die man nicht mag, als bloße Herrschaftsmanifestationen zu diskreditieren. In seiner Zirkularität ist das ein sich gegen Einwände völlig immunisierendes, aber deswegen politisch ziemlich wirkungsvolles Macht-Verfahren, weil es selbst dann, wenn es den bekämpften Positionen zubilligt, aus Überzeugung und subjektiv nicht einfach aus Machterhalt heraus zu handeln, dieses Bewußtsein immer noch auf eine nur noch nicht selbstreflexiv gewordene Machtagenda zurückführt.
Das ist unwiderleglich. So ist der nur männliche Priester eo ipso eine Instanz zur Unterdrückung der Frau, die tridentinische Lehre vom substantiellen Unterschied von Laie und Priester ein Unterdrückungsmechanismus des Gottesvolkes, der Zölibat ein repressives Mittel zur Botmäßigmachung der Priester wie auch die monogame heterosexuelle Ehe und das moralische Verbot außerehelichen Geschlechtsverkehrs Ausdruck einer Lustfeindlichkeit sind, deren Agenda wiederum die Unterwerfung der Individuen ist, die Sakralität des Weiheamtes ist die Ermöglichungsbedingung für klerikale Herrschaft usw. usw. Und jeder Einwand gegen diese Reduktionen erscheint sogleich als eine Bestätigung der Kritik. Es ist wie in der Psychoanalyse: erhebt der Patient gegen eine Interpretation seines Analytikers Einspruch, ist dieser wieder nichts anderes, als eine unbewußte Abwehr und zeigt, wie recht der Analytiker hat. Der Patient verliert immer.
Warum geht man sich nicht einfach aus dem Weg?
Deswegen halte ich es auch für müßig, mit der synodalen Revolutionsgarde in die Diskussion dogmatischer Fragen einzutreten. Die Argumente können nicht mehr verfangen. Hier möchte ich vielmehr die Frage aufwerfen, warum diese Leute die katholische Kirche nicht einfach verlassen. Kriege entstehen gewöhnlich dann, wenn die verfeindeten Parteien aus Ressourcenknappheit um dieselbe Beute kämpfen. Das scheint, jedenfalls auf den ersten Blick, bei unseren innerkirchlichen Konflikten aber gar nicht der Fall zu sein. Denn moderne Gesellschaften ermöglichen ja eine nahezu beliebige Pluralität von religiösen Institutionen, deren Entstehen gar nicht mehr blutig erkauft werden muß. Der Papst hat kürzlich im Blick auf den Synodalen Weg entsprechend darauf verwiesen, dass es ja bereits eine – wie er meinte sehr gute – evangelische Kirche in Deutschland gebe, die alle Forderungen der synodalen Majorität präzise erfülle, und also gar keine Notwendigkeit bestünde, die katholische Kirche noch in eine protestantische zu transformieren.
In den diversen Subsystemen des heutigen Protestantismus könnten sich jene einfinden, die davon überzeugt sind, dass die katholische Kirche in ihrer klassischen Lehre und Organisation bis ins Mark verderbt und notorisch vorgestrig sei. Außerdem genießt die Synodenmajorität das ganze Wohlwollen der linksgrün imprägnierten Gegenwartskultur und des politischen Establishments, so dass im Falle eines formellen Schismas sicher auch materielle Regelungen gefunden werden könnten, durch die niemand größeren Schaden litte. Striet und etliche weitere für den Synodalen Weg aktive Professoren sind ohnehin Staatsbeamte. Das heißt, man könnte sich aus dem Wege gehen und wechselseitig in Ruhe lassen. Warum geschieht das nicht?
In gewisser Weise läßt sich diese Beharrungskraft noch immer auf der Seite des lutherischen Reformationspathos‘ verbuchen. Denn auch Luther wollte keine neue Kirche gründen, sondern die „römisch-katholisch“ verfremdete auf jenen normativen biblischen Zustand zurückführen, den er dafür hielt. Sofern zu diesem Anliegen an zentraler Stelle die Überwindung der lehramtlichen Hierarchie sowie des – zölibatären – Weihepriestertums und des Begriffs der Messe als Opfergeschehen zählt, gibt es zwischen der Programmatik des Synodalen Weges und dem ursprünglichen Reformationsansinnen offensichtliche inhaltliche Übereinkünfte. Vor allem gibt es aber die Übereinstimmung, dass das Reformationsprojekt seinem Begriff nach erst dann als vollendet gelten kann, wenn die eine Kirche Christi von ihren vorgeblichen katholischen Verzerrungen ganz bereinigt worden ist [22].
Die „Reformation 2.0“ will Befreiungsobjekt sein
Damit ist jedoch zugleich schon die Differenz der „Reformation 2.0“ zu Luther gegeben. Denn Luther besaß in seinem antikatholischen Widerstand gleichwohl ein abgrenzungsstarkes eigenes Verständnis von christlicher Identität, das nach wie vor das Bekenntnis zu Jesus Christus als der menschgewordenen zweiten Person der Trinität impliziert und im Übrigen an der Lehre von alleinigen Heilsmittlerschaft Christi und seines Sühnetodes bis zu der von der Heilsnotwendigkeit der Taufe, vom Jüngsten Gericht sowie der Existenz des Teufels und der Hölle keinen Zweifel aufkommen läßt. Außerdem ist auch die Schriftreferenz nach der ursprünglichen lutherischen (und calvinischen) Überzeugung so durch den Heiligen Geist geleitet, dass in den gläubigen Subjekten von selbst ein einheitliches Schriftverständnis entstehen soll, das die Grundlage für die kirchliche Bekenntniseinheit bildet, deren Notwendigkeit und Möglichkeit die Reformatoren ebenfalls nie bezweifelten.
All diese Positionen unterfallen jedoch ebenso dem Verdikt der Reformation 2.0 wie die traditionelle katholische Dogmatik und Morallehre, sie sind mit dem libertarischen Ansatz völlig inkompatibel. Die hier an die Wurzel gelegte Axt fällte den Protestantismus ebenfalls, wenn er sich nicht, jedenfalls in der Gestalt der heutigen EKD und des Anglikanismus, selber schon als „Kirche der Freiheit“ libertarisch aufgestellt und damit von der lutherischen Theologie um Lichtjahre entfernt hätte. Aber analog zum ersten Reformationsereignis kann auch das libertarische Anliegen erst dann zur Ruhe kommen, wenn der eigentliche Gegner, nämlich ein starker Vernunft- und Wahrheitsbegriff, dessen Anwalt die katholische Kirche immer war, grundsätzlich aus der Welt geschafft ist. Auch die Reformation 2.0 begreift sich als ein universal ausgreifendes Befreiungsprojekt, das seinen Furor allerdings nicht mehr aus einer göttlichen Normativität, sondern gegenläufig gerade aus dem Willen zur Emanzipation der Freiheit aus allen bindenden Offenbarungsverständnissen bezieht.
Insofern ist es nachvollziehbar, dass sich Striet selber in der Nachfolge Kants als Vertreter der Aufklärung sieht, die er mit der Habermas’schen Diskurstheorie anreichern und bis zu dem Punkt treiben will, dass der Mensch in seiner auch material selbstbestimmten Autonomie sogar Gott auf Augenhöhe begegnen zu können meint. Gott kann im Horizont des postmetaphysischen Vernunftbegriffs, der Wahrheit zu „diskursiv bewährten“ Geltungsansprüchen deflationiert, nicht mehr jene dem Menschen immer schon vorgegebene Wahrheit sein, die allein den Menschen frei macht. Der entsprechende johanneische Satz wird von Striet explizit verworfen[23].
Gott darf das um unserer Selbstermächtigung willen nicht mehr sein, dazu wird dieses Vernunftverständnis ja gerade entworfen. Davon, dass wir, wie Karl Rahner sagte, gerade im Maße unserer Abhängigkeit von Gott und unserer Unterwerfung unter ihn wir selber werden, Autonomie und Abhängigkeit sich hier also streng proportional verhalten, kann keine Rede mehr sein.
Gott wird zur Hülle einer Selbstanbetung
Auch wenn sich bei Striet und den Synodalen im Unterschied zur radikal-atheistischen Selbstermächtigungsposition etwa Foucaults oder Butlers immer noch ein formaler theologischer Restbestand findet, wird das Wort „Gott“ doch zu einer Hülle, in der das Herr-Subjekt-Sein des Menschen selber angebetet wird. Gott ist zu einer bloßen Ermöglichungsbedingung menschlicher Selbstherrlichkeit depotenziert, der sodann vor der totalen Autonomie des Menschen respektvoll-anerkennend zurückweicht und als das schlechthin unerkennbare „Ding an sich“ in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Eine als Seins- und Wahrheitsgeschehen begriffene göttliche Selbstoffenbarung kann es nicht mehr geben, sie müßte ins Leere laufen. Es gibt ja, wie Striet sagt, nur noch „Reflexionszirkel“, also die Bewußtseins-Götter unserer Narrative.
Diese radikale Freilassung in unsere nicht mehr durch die göttliche Wahrheit normierten Selbst-, Welt- und Gottesverständnisse soll wie bei Striet auch bei Wendel Ausdruck des biblischen Bundesschlusses Gottes mit dem Menschen sein. Als „Gottesgeschenk der Autonomie“ feiert Bischof Overbeck beim Synodalen Weg diesen Selbstermächtigungsvorgang. Für diese Interpretation spricht zwar vom biblischen Textbefund her gar nichts, aber in ihrer Willkür ist sie präziser Ausdruck des Willkürgeschehens, das die Etablierung dieses auch die Schriftexegese sowie den Umgang mit der kirchlichen Lehre leitenden Freiheitsbegriffs überhaupt darstellt. Striet sagt es ganz unverblümt: „Und wer sich dazu bestimmt hat, Freiheit als das Höchste zu wollen …“[24] Gerade diese Zirkularität des Willens zum Willen bildet die Logik des libertarischen Freiheitsbegriffs. Er gilt, weil er gelten soll, er ist eine Setzung, eine Frage des Geschmacks[25].
Eine Neuerfindung der Religion
Die in den 1990er Jahren entwickelte pluralistische Religionstheologie John Hicks, Paul Knitters oder Perry Schmidt-Leukels hat erkenntnistheoretisch schon ganz ähnlich geredet und gefordert, die Religionen müßten lernen, ihre eigensinnigen Wahrheitsansprüche abzuschmelzen und sich als lediglich kulturell bedingte diverse Manifestationen des ewigen und ewig unergiebigen Kreisens um das Numinose zu verstehen. Im Synodalen Weg und den ihn orchestrierenden theologischen Verlautbarungen kommt eine Entwicklung zu ihrem radikalen Austrag, die nicht nur philosophie-, sondern auch theologiegeschichtlich schon lange unterwegs ist und sich in den vergangenen 60 Jahren nochmals beschleunigt verdichtet hat. So unterschiedlich die moraltheologischen und dogmatischen Entwürfe im Einzelnen auch sein mögen, sie kommen vielfach doch darin überein, die Modernekompatibilität zum entscheidenden hermeneutischen Maßstab und daher vor allem die menschliche Autonomie über die Abhängigkeit von Gott ermächtigt und zu diesem Zweck zugleich die Vernunft- bzw. Wahrheitsfähigkeit des Menschen entmachtet zu haben.
Betrachtet man diese Entwicklung, wird man kaum umhinkommen festzustellen, dass es hier nicht einfach nur um eine Neuerfindung des Christentums, sondern der Religion als solcher geht. Dieses hochambitionierte Projekt, das ebenso die Agenda der modernen Kultur im Ganzen ist, stellt vermutlich sogar das zentrale Moment der Heidegger’schen Machenschaft dar. Jetzt ist erst einmal die katholische Kirche an der Reihe, dabei soll es aber nicht sein Bewenden haben. Entstehen soll die radikal anthropozentrische Religion 2.0. Ist es aber so weit gekommen, wird man Heidegger beipflichten müssen, dass der Gott und die Götter entflohen sind[26]. Sie verweigern die Gewalttat, ihre eigene Autonomie dadurch einzubüßen, dass sie durch das verdinglichende Nadelöhr unserer selbstbezüglichen Subjektivität gefädelt werden und nicht mehr als die erscheinen dürfen, die sie von sich selbst her sind.
Wie die neuzeitliche Aufklärung überhaupt, ist auch die Mission der Religion 2.0 fundamental intolerant. Sich nicht zur Striet’schen Freiheit befreien lassen zu wollen ist unstatthaft. Als sich der Vatikan vor einigen Jahren die Freiheit nahm, mit der Piusbruderschaft in einen Dialog zu treten, stellte Striet ziemlich aggressiv die Frage, ob wir denn nun auch in der Kirche beim „anything goes“ angekommen seien[27].
Der von Striet inkriminierte Punkt war hier die Frage der Religionsfreiheit bzw. der Menschenrechte, die die Piusbruderschaft durch deren Rekurs auf die einschlägigen lehramtlichen Aussagen der Pius-Päpste anders als die liberale Theologie beantwortet. Mir geht es jetzt nicht um die Diskussion dieses Themas, sondern nur um den offenkundig autoritären Charakter der Libertären, der für das heute tonangebende kirchliche Establishment repräsentativ ist: weichen die anderen von den eigenen Narrativen ab, wird sogleich nach diskurspolizeilichen Maßnahmen gerufen, die darauf abzielen, der inkriminierten Position und deren Vertretern im Diskurs der Aufgeklärten kein Heimatrecht mehr einzuräumen. So fordert der Synodale Weg ungeniert, zukünftig sollten nur noch korrekt Denkende in der Kirche Leitungspositionen bekleiden dürfen und zur Säuberung der Kirche von Subjekten mit falschem Bewußtsein wolle man mit staatlichen und sonstigen öffentlichen Institutionen zusammenarbeiten[28]. Eine Inquisition ersetzt die andere, wobei die frühere die gnädigere war.
Entschlossenheit des Dekonstruktionswillens
Natürlich hat Magnus Striet Recht, wenn er nicht müde wird zu betonen, dass es von Anfang an unzählige Interpretationsvarianten der Bibel und katholischen Lehre gegeben hat. Das ist aber kein durchgreifendes Argument für den Synodalen Weg, im Grunde dient es nur der Verschleierung der Machtagenda. Denn es waren kirchliche Instanzen wie die Konzilien, die in relevanten Fällen die katholisch unverträglichen Interpretationen anathematisiert und im Grunde fortlaufend das praktiziert haben, was schon Paulus im Blick auf seine Gemeinden gemacht hat. Sicher sind auch diese Lehrfixierungen wiederum Interpretationen, aber eben solche, die in ihrem Selbstverständnis für alle Katholiken bindend sind. Auch die Behauptung des unveränderbar bindenden Charakters ist eine spezifische theologische Interpretation, aber katholisch zu sein heißt eben, diese Interpretation im Unterschied zu anderen zu akzeptieren. Freilich kann man diese Interpretation für falsch halten. Aber man kann schlecht leugnen, dass es, in einer ganz neutralen religionswissenschaftlichen Perspektive, das ist, was faktisch für die katholische Identität essenziell ist. Nimmt man diese Identität weg, ist sie eben verschwunden. Jedenfalls dann, wenn die alte zweiwertige Logik noch Gültigkeit besitzen sollte, kann man schwerlich zugleich katholisch und nicht katholisch sein wollen.
Dieser Widerspruch löst sich allerdings dann auf, wenn es in der Sache gar nicht mehr um eine Reform der katholischen Kirche als solcher, sondern eben um deren Aufhebung in die Religion 2.0 geht. Die klassische katholische Kirche muß einfach verschwinden, sie ist ein auch politisch viel zu gefährlicher Gegner. Man denke nur an die von Johannes Paul II. formulierten Bestimmungen in „Ordinatio sacerdotalis“. Menkes Aussage, die Kirche sei „mit ihrem sakramentalen Verständnis der Geschlechterdifferenz das letzte Bollwerk gegen eine ungeheure Vergleichgültigung“[29], ist völlig zutreffend. Die Wut, die sich auf dem Synodalen Weg gegen die katholische Tradition, für die diese Geschlechterordnung essentiell ist, Bahn gebrochen hat, indiziert die Entschlossenheit des Dekonstruktionswillens. Und die effiziente Überwindung der machenschaftsfeindlichen Widerständigkeit der Kirche funktioniert nur aus deren Innerem selbst heraus. Deswegen wandern diese Leute, vor allem die ideologischen Drahtzieher, nicht ab. Es muß eine interne Kolonialisation sein, die schließlich eine Revolution im Chorrock gebiert, denn alles andere, das zeigt die Geschichte der von außen kommenden Kirchenverfolgung hinlänglich, führt sogar zum Gegenteil des Intendierten.
Genau dieses Ziel verfolgt die Reformation 2.0, die ebenso wie in den Positionen Striets auch im Plädoyer Wendels für ein „undogmatisches Christentum“ gut abgebildet ist, in dem das Undefinierte zur eigentlichen Definition der Kirche werden soll. Ein Kirchenbild erscheint vor uns, in dem alle übernatürlichen Dimensionen abgeschmolzen und die klassischen Topoi des geistlich-mystischen Lebens wie die Heiligung der Seelen, des Messopfers, der Anbetung, der Umgestaltung in Christus und der Sühne komplett verschwunden sind.
Man muß sich nur die abstrakten religiösen Symboliken und gräßlichen Liturgien des Synodalen Weges anschauen und weiß, wie platt und immanentistisch diese Kirche aufgestellt sein wird, deren primäre Anliegen mit denen des heutigen links-grünen Mainstreams ununterscheidbar verschmolzen sind. Dieses Gebilde hat mit der Kirche des Augustinus, Edith Steins oder Padre Pios nichts mehr zu tun. Aber nur die derart in ihren zentralen Dimensionen verflüssigte Kirche stellt kein Hindernis mehr für die globale Religion 2.0 dar.
5. Konsequenzen
Es gehört zum guten Ton des Synodalen Weges, darauf zu insistieren, dass alle Sätze, damit auch alle formellen lehramtlichen Aussagen, veränderbar und also prinzipiell reversibel sind. Wahr ist allein, dass es keine unwandelbaren Wahrheiten, also keine Wahrheit gibt [30]. Dagegen gibt es kein durchgreifendes theoretisches Argument, weil alle entsprechenden Argumente schon auf das Geleugnete zurückgreifen müssen. Auch der Einwand, dieser Satz sei selbstwidersprüchlich, wird mit der Bemerkung zurückgewiesen, er stelle lediglich ein analytisches, deskriptives Urteil und keine weitere, für sich Wahrheit beanspruchende inhaltliche Position dar.
Die Wahrheitsleugnung ist selber auch überhaupt keine theoretische, sondern eine moralische Angelegenheit, und das einzige Argument dagegen lautet „et respice finem“, was seine biblische Version bei Matthäus 10,28 findet. Aber selbst das wird wirkungslos bleiben, weil diese neutestamentlichen Sätze schon im hermeneutischen Vorfeld als bloß zeitbedingte Interpretamente systematisch entschärft worden sind. Sie sind unbelehrbar geworden und haben sich selber, menschlich gesprochen, ihrer Bekehrungsmöglichkeit beraubt.
In der kirchlichen Konsequenz heißt das, dass dieser Haltung mit den Mitteln der klassischen dogmatischen Erkenntnislehre – etwa mit Konzilsbeschlüssen oder päpstlichen Definitionsakten – allein nicht mehr begegnet werden kann. Die Vertreter des Synodalen Weges wie Bischof Bode sagen das auch ganz offen: selbst wenn das römische Lehramt Sätze mit höchstem, endgültigem Verbindlichkeitsanspruch formuliert, gelten diese Sätze doch nicht als solche, sie sind ihrer geschichtlichen Natur nach immer überholbar.
Das würde dann auch für alle römischen Verwerfungen der Positionen des Synodalen Weges gelten. „Roma locuta, causa finita est“, ist aufgrund dieser philosophischen Präsuppositionen, die sich nach langem Vorlauf nun mit dem Synodalen Weg vollends in die politische Realität des entfesselten Selbstermächtigungswillens übertragen haben, ebenso zur Makulatur geworden wie die Verfahrensregelungen beim Synodalen Weg selbst, die, wie wir erlebt haben, sogleich gebrochen werden, wenn sie die revolutionären Zwecke behindern.
Beschwichtigungsrhetorik als politische List
Man muß sich ungeschminkt vergegenwärtigen, was das für das kirchliche Leben bedeutet. Logisch gibt es für diese konfligierenden Positionen kein tertium mehr, es ist schlicht ein unversöhnbarer Widerstreit. Er bezieht sich nicht einfach auf diesen oder jenen materialtheologischen Gegenstand, sondern auf die alles umgreifende Formalität der katholischen Kirche selber, auf die schlechthin grundlegende, buchstäblich über alles entscheidende Erkenntnis- und Wahrheitsfrage als solche. Das, was etwa die Bischöfe Bode und Bätzing verlautbaren, eliminiert die Identität der katholischen Kirche. Das wissen die Herren ganz genau, und sie wissen, dass die immer wieder eingestreuten Beschwichtigungs-Rhetoriken nur eine politische List sind. Damit wissen sie ebenfalls, dass die Auskunft Bätzings, der Synodale Weg wolle niemandem etwas wegnehmen, albern ist. Würde das inaugurierte Programm exekutiert, bliebe, wie Bischof Bode einräumt, „kein Stein auf dem andern“, und das würde logischerweise alle betreffen. Und präzise darum geht es in diesem Projekt der Moderne – den Katholiken das Katholische wegzunehmen.
Die politische Situation, in der wir gegenwärtig stehen, ist unübersichtlich. Der Ad-Limina-Besuch der deutschen Bischöfe hat das Mißfallen Roms, und zwar sowohl des Papstes als auch der Dikasterienleiter, am Synodalen Weg nochmals deutlich gemacht. Noch scheint Rom aber die harte disziplinäre und juristische Konfrontation zu scheuen, sei es, dass den Bischöfen die Fortsetzung des Synodalen Weges formell untersagt, oder die entscheidenden Protagonisten gar ihrer Ämter enthoben und im äußersten Falle exkommuniziert würden. Ich vermute, dass die eigentlich jakobinische Bischofsfront sich mittlerweile so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass sie bereits bei einem förmlichen Verbot des Synodalen Weges mindestens mit ihrem Rücktritt reagierte, vielleicht aber auch zum Protestantismus oder, wahrscheinlicher, zu den Altkatholiken überträte. Das könnte auch für eine gewisse Zahl von Priestern gelten.
Wohin gehen die aktivistischen Laien?
Von den beim Synodalen Weg aktiven ehrenamtliche Verbandsfunktionären würden sich wohl etliche den schismatischen Bischöfen anschließen, möglicherweise aber auch unabhängig vom Bischofsverhalten bereits dann aus der Kirche austreten, wenn es zu einem römischen Verbot käme. Das ließe sich vor dem Hintergrund des ja auf Weltgeistebene angesiedelten Religionsmodifizierungsprojektes schönreden als jetzt erst einmal angezeigter politischer Widerstandsakt oder als Folge unerträglich gewordener, durch die Menschenfeindlichkeit bedingter Frustration oder im Blick auf die Notwendigkeit, das Irritationspotential für den eigenen Familienzusammenhang zu reduzieren. Irme Stetter-Karp hatte ja hinsichtlich des unerwarteten ersten Abstimmungsergebnisses beim letzten Synodaltreffen schon erschüttert ihre Schwierigkeit formuliert, das in ihrer Familie kommunizieren zu können. Ein Argument von Rang.
Die Schar der hauptamtlichen Laien, die ginge, wäre aber wohl ziemlich überschaubar, schließlich muß man, auch wenn ansonsten sicher niemand ins Nichts fiele, an die eigene Rente denken. Das ließe sich hinwiederum schönreden als Verbleib im Feindesland aus Treue zum Modernisierungsprojekt. Es gilt eben, unter der ermutigenden Zusage Gottes für die Menschen und die Menschheit dicke Bretter zu bohren, nach wie vor gemeinsam außer- und innerhalb der Kirche. Dass jedoch die Bischofsmajorität, wenngleich sie – aus welch‘ zweifelhaften sachlichen und charakterlichen Gründen auch immer – bei den synodalen Beschlüssen oftmals mitzugestimmt oder jedenfalls nicht opponiert hat, den förmlichen Bruch mit Rom und der Weltkirche wagte oder auch nur im Geheimen wünschte, ist eher unwahrscheinlich.
Strukturell und staatskirchenrechtlich wenig Folgen
So gibt es gute Gründe zu vermuten, dass bei einem robusteren römischen Auftreten, selbst wenn sich einige Bischöfe daraufhin von Rom lossagten, strukturell und auch staatskirchenrechtlich gar nicht so viel passierte. Der medial inszenierte Theaterdonner wäre allerdings erheblich, dies jedoch nur für kurze Zeit, denn tatsächlich interessiert sich die säkularisierte Öffentlichkeit und selbst die überwiegende Mehrheit der weitgehend inaktiven Kirchenmitglieder für den Synodalen Weg überhaupt nicht. Und genau dies gehört zu den eigentlichen Grotesken des Frankfurter Ereignisses, dass es die öde Manifestation der ewigen narzisstischen Selbstbezüglichkeit einer bestimmten, noch immer durch die 1970er Jahre geprägten ideologischen Funktionärsgruppe ist, die lernresistent an den echten Problemlagen der Gegenwart und Herausforderungen der Kirche vorbeimarschiert. Diese eigentümliche Ungleichzeitigkeit hat etwa auch Kardinal Ouellet beim Ad-Limina-Besuch zur Geltung gebracht, indem er darauf hinwies, „dass die Agenda einer begrenzten Gruppe von Theologen von vor einigen Jahrzehnten“, die nun „plötzlich zum Mehrheitsvorschlag des deutschen Episkopats geworden ist“, die kirchlichen Probleme wie die massive Abwanderung der Gläubigen aus der Kirche, den Exodus der Jugend und die Vertrauenskrise der Gläubigen nicht lösen würde[31].
Deswegen müßte man aus katholischer Perspektive gerade sagen, dass ein durch ein schärferes römisches Verhalten katalysiertes Abwandern der oben genannten Klientel alles andere als ein Schaden wäre. Eine katholische Kirche in Deutschland ohne jene, die katholisch, aber anders katholisch als katholisch sein wollen, ohne ZdK, BdkJ und Maria 2.0, ohne all die Offenbarungswidrigkeiten und Blasphemien, würde den göttlichen Gnadenwillen für die an ihrem Opportunismus, ihrer eigenen Dekadenz und Mediokrität siech gewordenen Kirche vielleicht wieder freisetzen können. In diesem Erwägungszusammenhang müßte man wohl auch sagen, dass die im Falle der geschilderten Kirchenaustritte vermutbare relative Folgenlosigkeit politischer Art in der Sache gar nicht wünschenswert wäre. Der Nihilismus, die lebensfeindliche Dekadenz des jetzigen kirchlichen Zustandes hängt praktisch an durchaus wichtiger Stelle damit zusammen, dass es eine unheilvoll gewordene Nähe der Kirche zum Staat gibt und all das, was der geistlichen Substanz der Kirche so sehr schadet, gut finanzierbar ist. Man kann in Frankfurt komfortabel tagen.
Der Synodale Weg in Wahrheit strukturkonservativ
Kirchensteuer, staatliche theologische Fakultäten, Theologen als Staatsbeamte, vom Staat bezahlte Bischöfe – diese Regelungen sind noch immer das späte Echo der konstantinischen Wende und der Reichstheologie. Von daher läßt sich der Synodale Weg sogar als konservatives Ereignis beschreiben: Man will, und zwar um jeden Preis, das alte Paradigma nicht verlassen und eine politisch und sozial relevante Macht bleiben. Wie es in Guiseppe Tomasi di Lampedusas Roman „Der Leopard“ aus dem Munde des jungen revolutionären Adeligen heißt: Alles muß sich ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Deswegen läßt die Revolutionspartei des Synodalen Weges immer mal wieder warnend verlautbaren, dass ohne die bewährte Staatsnähe und Kirchensteuer die Kirche in finstere fundamentalistisch-sektenartige Fahrwasser geriete und sich damit der Glanz aufgeklärter Rationalität, der in Sonderheit von den staatlichen theologischen Fakultäten und dem Frankfurter Geschehnis als politischem Instrument dieser Theologie nicht zuletzt auf die ganze Kirche ausstrahle, verflüchtigten könnte.
Da war Benedikt XVI. sehr viel progressiver als er weiland in seiner berühmten Freiburger „Entweltlichungsrede“ von den entsetzten Bischöfen forderte, endlich die Säkularisierungsprozesse anzuerkennen, auf alte Privilegien und staatliche Absicherungen zu verzichten und mutig wieder zu einer „kleinen Herde“, also zum neutestamentlichen Normalfall der Kirche in einer glaubenslosen Welt zu werden. Wenn jemand bereit war, um der Selbstregeneration der Kirche willen auf den Geldfetisch zu verzichten und alte Zöpfe abzuschneiden, dann Benedikt, der schon als junger Theologe in seinem noch immer lesenswerten Aufsatz „Die neuen Heiden und die Kirche“ ähnlich redete wie in Freiburg[32]. Eine solche Position setzt aber einen lebendigen Glauben voraus, der allein jene Souveränität ermöglicht, sich um die eigene Zukunft überhaupt keine Sorgen zu machen.
Der echte Glaube benötigt auch keine Pastoralpläne. Und er benötigt keinen peinlichen Kotau vor dem Staat und der säkularisierten Öffentlichkeit – wie etwa den, den Bischof Bätzing im März dieses Jahres bei einem Interview in der „Bunten“ hingelegt hat, bei dem er das gesamte links-liberale Erwartungsrepertoire schamlos bediente, um auf die letzte Frage des Journalisten, welche Frau er nach Maria am meisten bewundere, noch zu sagen: Angela Merkel. Der Journalist sprach hier allerdings von der „Jungfrau Maria“. Was hätte der Bischof wohl auf die Frage nach Marias Jungfräulichkeit selbst geantwortet? Man hat es schon im Ohr. Das alte Verständnis der Jungfrauenschaft der Gottesmutter – also Maria 1.0 – entspräche sicher nicht mehr dem Stand heutiger wissenschaftlich-theologischer Forschung. Und weil die ja recht maßgeblich an den staatlichen theologischen Fakultäten betrieben wird, muß sich eben alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist.
„Um Gottes willen – Klarheit!“
Aber genau deswegen sollten Katholiken sogar ein durch ein härteres römisches Vorgehen möglicherweise befördertes förmliches Schisma oder grundstürzende staatskirchenrechtliche Veränderungen nicht fürchten. Wünschenswert wäre ein solches römisches Vorgehen im Kern deswegen, weil Magnus Striets Aussage wahr ist, dass das Schisma in der theologischen Sache bereits da sei. Auch wenn Rom relativ verhalten bleibt und der sich nun auch innerkirchlich bis ins Unerträgliche aufplusternden modernen Subjektivität nicht massiver entgegentritt, hebt sich diese Dissonanz ja nicht auf, sie wird nur auf Dauer gestellt und produziert immer üblere Verwüstungen durch das Projekt der Aufhebung der katholischen Kirche in die anthropozentrische Religion 2.0.
Heute benötigen wir dringend wieder das, was Eberhard Jüngel seinerzeit im Blick auf die von ihm kritisierte ökumenische Erklärung zur Rechtfertigungslehre forderte: „Um Gottes willen – Klarheit!“ Sollten nämlich einzelne Bischöfe einfach ungehindert die Synodale Programmatik in ihren jeweiligen Diözesen umsetzen können oder der Synodale Rat der sich zum Maß aller Dinge ermächtigenden Subjekte tatsächlich politisch etabliert werden, wäre zu erwarten, dass dann, und zwar immer unverhaltener, die Widerständigen abgesetzt und exkommuniziert würden. Es ist alles angekündigt und hat ja längst begonnen, und niemand wird später sagen können, er habe es nicht gewußt.
Unter dieser Voraussetzung erlaube ich mir abschließend einen Rat an die wenigen widerständigen deutschen Bischöfe: Nehmt dann die Priesterflüchtlinge bei euch auf, schließt euch mit den traditionstreuen Priestern zusammen und nutzt den euch noch verbliebenen Einfluß. Fürchtet den offenen Konflikt nicht mehr. Die Zeit der Harmonien, nach denen sich fromme Seelen oft so sehr sehnen, ist abgelaufen, der Krieg wurde erklärt. Aber das ist ja von Anfang an Bestandteil der christlichen Lehre: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert (…) und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein“ (Mt 10, 34;36).
Die anderen benutzen und mißbrauchen ihre amtliche Macht ganz ungeniert und pokern mit der Verzagtheit ihrer Gegner. Vielleicht sollten die Gläubigen die Inhaber des Weiheamtes häufiger daran erinnern, dass sub specie aeternitatis viel auf dem Spiel steht und Lukas 22,31, „Simon, Simon, der Teufel hat verlangt, euch zu sieben wie den Weizen“, noch immer gilt.
[1] Bischof Rudolf Vorderholzer: Persönliche Erklärung, https://bistum-regensburg.de/news/persoenliche-erklaerung-von-bischof-dr-rudolf-voderholzer–6979.
[2] Birgit Kelle: Der Synodale Weg kippt „queer“, 07.09.22, https://neueranfang.online/der-synodale-weg-kippt-queer/.
[3] Vgl. dazu Karl-Heinz Menke: Das libertarische Verständnis von Glauben und Offenbarung. Saskia Wendels Plädoyer für ein undogmatisches Christentum, in: Forum Katholische Theologie 38(2022) 116-134.
[4] Thomas Pröpper: Erlösungsglaube und Freiheitsgeschichte. Eine Skizze zur Soteriologie, München 1985.
[5] Vgl. Karl-Heinz Menke: Ist die Einheit noch zu retten?, 28.06.22, https://neueranfang.online/ist-die-einheit-noch-zu-retten/.
[6] Bischof Rudlf Voderholzer: „Der synodale Weg kennt keine Stoppschilder“, Tagespost vom 14.09.2022, https://www.die-tagespost.de/kirche/synodaler-weg/der-synodale-weg-kennt-keine-stoppschilder-art-232234/.
[7] Magnus Striet: Naturrechtsfantasien und Zeitgeist, https://www.herder.de/hk/hefte/archiv/2017/4-2017/naturrechtsfantasien-und-zeitgeist-eine-replik-auf-karl-heinz-menke/.
[8] Erberhard Jüngel: Gott als Geheimnis der Welt, Tübingen 1978, 16.
[9] Vgl. Martin Heidegger: Nietzsche II, Gesamtausgabe (GA), Bd. 6.2, Die Metaphysik Nietzsches, 236ff.
[10] Vgl. Wolfhart Pannenberg, Theologie und Philosophie. Ihr Verhältnis im Lichte ihrer gemeinsamen Geschichte, Göttingen 1996, 133-141.
[11] Horst-Eberhard Richter: Der Gotteskomplex. Die Geburt und die Krise des Glaubens an die Allmacht des Menschen, Hamburg 1979.
[12] In der Deskription hervorragend: Hartmut Rosa: Unverfügbarkeit Salzburg 2018.
[13] Vgl. Robert Spaemann/Reinhard Löw: Die Frage Wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens, München/Zürich 1981.
[14] Vgl. Meuser: Freie Liebe. Über neue Sexualmoral, Basel 2020, 138ff.
[15] Foucaults Text in: Foucault: Analytik der Macht, Frankfurt 2005, 301-315; Butler in: Uwe Wirth (Hg), Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt 2002, 301-320.
[16] Martin Heidegger: Bremer und Freiburger Vorträge, Gesamtausgabe (GA), Bd. 79, 26.
[17] Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes, Einleitung, Bamberg/Würzburg 1807.
[18] Beispielhaft Birgit Kelle: «Transkids»: England macht eine beispielhafte Kehrtwende in der Behandlung, https://www.nzz.ch/meinung/transkids-england-macht-eine-beispielhafte-kehrtwende-ld.1598408
[19] Zit. nach Thomas Thiel: Die Überwindung des Fleisches, FAZ vom 29.1.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/abschaffung-des-koerperlichen-geschlechts-darum-wird-geschwiegen-17169758.html.
[20] Martin Heidegger: Überlegungen XII – XV („Schwarze Hefte“ 1939–1941), Gesamtausgabe (GA) Bd. 96, 267.
[21] Zum gesamten Themenkomplex vgl. Karl-Heinz Menke, Sakramentalität: Wesen und Wunde des Katholizismus, Regensburg 2012.
[22] Erhellend dazu Hilaire Belloc: Die großen Häresien, Bad Schmiedeberg 2019, bes. 133-186.
[23] Magnus Striet: Ernstfall Freiheit, Freiburg im Breisgau 2018, 148.
[24] Magnus Striet: Naturrechtsfantasien und Zeitgeist, https://www.herder.de/hk/hefte/archiv/2017/4-2017/naturrechtsfantasien-und-zeitgeist-eine-replik-auf-karl-heinz-menke/.
[25] Martin Heidegger: Holzwege, Gesamtausgabe (GA), Bd. 5, Die Zeit des Weltbildes (1938).
[26] Magnus Striet: anything goes?, Die Zeit vom 21.10.16, https://www.zeit.de/2016/44/piusbruderschaft-vatikan-anerkennung
[27] Vorlage des Synodalforums II „Priesterliche Existenz heute“ zur Ersten Lesung auf der Vierten Synodalversammlung (8.-10.9.2022) für den Handlungstext „Enttabuisierung und Normalisierung – Voten zur Situation nicht-heterosexueller Priester“, https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SV-IV/SV_IV_-_Synodalforum_II_-_Handlungstext.EnttabuisierungUndNormalisierung_-_Lesung1.pdf.
[28] Karl-Heinz Menke: Die Frage nach der Verbindlichkeit von „Ordinatio sacerdotalis“, Tagespost vom 27.7.2022, https://www.die-tagespost.de/sonder-texte/beilage/die-frage-nach-der-verbindlichkeit-von-ordinatio-sacerdotalis-art-230714.
[29] Beispielhaft Johanna Rahner: „Es gibt nicht nur die eine Wahrheit“, Die Zeit vom 03.09.15, https://www.zeit.de/2015/36/sexualitaet-umfrage-theologie-johanna-rahner.
[31] https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2022-11/wortlaut-ouellet-synodaler-weg-deutsch-kirche-bischoefe-kurie.html
[32] Josef Ratzinger, Die neuen Heiden und die Kirche, in: Hochland 51 (1958).